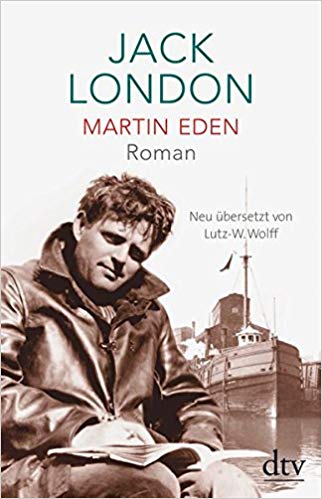Read this story in English.

Nach einem anstrengenden aber sonnigen Tag auf Pico führt mich am Abend der Weg zum Quarantänekloster vorbei an der Bowlingbar. Vor dieser bittet mich ein verlottert und zwielichtig aussehender Mann aufgeregt um 5 Euro, um sein Auto betanken zu können. Dann würde er nach Hause fahren, das Geld holen und mir zurückbringen. Viel Sinn ergibt das nicht, für mich noch weniger als für ihn, und ich höre schon zwei Lager aus der Leserschaft rufen: „Sei doch nicht so doof!“ und „Ach, was sind denn 5 Euro?“, wobei Letztere meine finanziellen Verhältnisse überschätzen.
Außerdem habe ich nur einen 10-Euro-Schein.
Den würde der Benzinfuchs natürlich auch annehmen, kein Problem: „In fünf oder zehn Minuten komme ich wieder zurück, ganz sicher. Du kannst die Leute in der Bar fragen, die kennen mich alle.“ Ich frage mich eher, wieso er sich mit seiner Darlehensanfrage nicht an die Freunde richtet. Da ich mir die Antwort schon denken kann, frage ich nach seinem Namen, ohne dessen Richtigkeit überprüfen zu können.
„Immanuel“.
Er kann kaum gewusst haben, dass ich Philosophie studiert habe, aber da spule ich natürlich sofort den Kategorischen Imperativ ab und gebe ihm die 10 Euro.
Die Leute in der Bar sehen mich mitleidig an, während ich draußen auf der Bank sitze und betont lässig über Wissenschaft im Kolonialismus lese.
Fünf Minuten vergehen.
Wie konnte er eigentlich mit dem Auto wegfahren, wenn er doch angeblich Benzin brauchte?
Zehn Minuten vergehen.
Wenn er genug Benzin hatte, um zur Tankstelle zu kommen, wieso fuhr er dann nicht zuerst nach Hause und holte das Geld?
Fünfzehn Minuten vergehen.
Und außerdem ist auf der anderen Straßenseite von der Bar ein Geldautomat.
Zwanzig Minuten vergehen.
Ich hatte nicht einmal daran gedacht, mir das Nummernschild zu merken.
Fünfundzwanzig Minuten vergehen.
Da ich gerade über Bronisław Malinowski und seine Feldstudien auf der Trobriand-Insel lese, betrachte ich die selbstverschuldete Situation als wissenschaftliches Experiment über die Ehrlichkeit der Picorianer.
Da fährt Immanuel mit seiner dunkelblauen Klapperkiste an mir vorbei, biegt ab, so dass er mich kaum übersehen haben kann, und düst den Berg hoch.
Dreißig Minuten vergehen.
Wollte er vielleicht sehen, ob ich wirklich so gutgläubig bin, zu warten? Wenn ich schon aufgegeben hätte, wäre er wahrscheinlich zu seinen Freunden in der Bar gegangen, und sie hätten sich im ganz wörtlichen Sinne auf meine Kosten amüsiert.
Aber da kommt er wieder den Berg herunter gerauscht, ruft „Ach, da bist du!“, wie wenn er mich auf der ganzen Insel gesucht hätte, und erklärt: „Du bekommst gleich dein Geld, keine Sorge. Ich muss nur noch zur Bank.“
Wieso fährt er dann stattdessen ständig durch die Stadt? Und wollte er das Geld nicht von zuhause holen?
Mir reicht es jetzt: „OK, dann fahre ich am besten mit zur Bank“, sage ich und steige einfach ein.
Damit hat er nicht gerechnet.
„Das ist keine gute Idee“, erklärt er, „denn ganz ehrlich, die Bank ist meine Mama.“ Er sieht etwa so alt wie ich aus, womit die Mutter eine Bank wäre, die auch im Rentenalter noch ihre Geschäftstätigkeit entfaltet.
„Kein Problem, dann fahre ich eben mit zu deiner Mama“, sage ich, betont so, wie wenn ich den ganzen Abend Zeit hätte.
„Das wird ihr aber nicht gefallen.“
„Du kannst doch um die Ecke parken, und ich warte im Auto.“
„Ich könnte dich auf den Berg fahren. Von dort oben gibt es einen fantastischen Blick über die Insel.“
„Nein danke, fahren wir lieber zu deiner Mama.“
„Ich kann dich auch nach Madalena fahren. Ich kann dich überall hin fahren, für wenig Geld. Viel günstiger als ein Taxi. Du kannst mich jederzeit anrufen, und ich hole dich ab.“
„Danke, aber jetzt fahren wir doch erst einmal zu deiner Mama.“
„Meine Mama ist schwerkrank. Ich kümmere mich schon seit Jahren um sie.“ Das sagt er betont rührselig, wie in einer Seifenoper.
„Hauptsache, sie hat noch 10 Euro“, denke ich, sage es aber nicht.
„Hast du schon zu Abend gegessen?“
Das hätte ich besser nicht verneinen sollen.
„Ich fahre dich zum Hafen, da gibt es ein gutes Lokal. All meine Freunde essen dort.“
„Nein danke“, sage ich, aber er fährt trotzdem zum Hafen. Zum Glück ist das Restaurant geschlossen. Übrigens fährt Immanuel wie der Henker, über Bordsteine, immer mit Höchstbeschleunigung. Aber er ist der einzige Fahrer, den ich auf Pico erlebt habe, der keinen Wert darauf legt, dass ich mich anschnalle. Vielleicht hofft er auf einen Unfall und das Ableben seines hartnäckigen Gläubigers.
„Ich fahre dich zum Supermarkt, da ist es sowieso viel billiger.“
„Nein danke, ich brauche echt nichts.“
Er fährt trotzdem hin. Zum Glück ist da auch schon geschlossen.
„Wenn du immer so planlos herumfährst, wundert es mich nicht, dass dir oft das Benzin ausgeht.“ Diesmal denke ich es nicht nur, sondern sage es auch. Langsam werde ich sauer.
Er fährt zu einer weiteren Bar, die ich schon vom Vorbeigehen kenne und wo immer die absolut dubiosesten Charaktere rumhängen, trinken und grölen. „Das sind meine Freunde“, stellt er mir drei Typen vor, die alle nach Drogen und Gefängnis aussehen. „Bleib doch ein paar Minuten hier und trink einen Kaffee. Ich komme gleich wieder.“
„Ich trinke abends keinen Kaffee, danke.“
„Einen Tee?“
„Ne, ich hätte jetzt echt lieber die 10 Euro.“
Er merkt, dass er mich nicht so leicht los wird. Wir gehen zu einem kommunal aussehenden aber heruntergekommenen Gebäude. „Hier wohnt meine Mama. Oje, das Haus ist leider geschlossen!“
„Was ist das hier?“ will ich wissen.
„Das Altersheim. Aber jetzt fällt mir ein, dass sie auf eine Party gehen wollte. Das kann sehr spät werden. Ich fahre dich besser in die Herberge und bringe das Geld dann später vorbei.“
Schön, dass die Mama wieder gesund ist.
„Ruf deine Mama halt an und frag sie, wo sie ist.“ São Roque ist nicht groß, weit kann die Alte nicht sein.
„Ich habe mein Telefon zu Hause vergessen.“
„Kein Problem, du kannst meins verwenden.“ Ich hoffe, so an eine Nummer zu kommen, falls ich wegen des Falles doch die Polícia Judiciária bemühen muss.
„Ich weiß die Nummer nicht.“
„Du weißt die Nummer von deiner Mama nicht, um die du dich so liebevoll kümmerst, weil sie schwerkrank ist, obwohl sie auf Partys geht?“
Jetzt fällt ihm nichts mehr ein. Zumindest für zwei Sekunden. Dann fährt ein Pickup-Truck mit abgeschnittenen Stauden auf der Ladefläche vorbei.
„Hey, das ist mein Cousin.“ Er ruft dem Fahrer nach, der tatsächlich stehenbleibt.
Die beiden unterhalten sich durchs offene Fenster. Mit Immanuel habe ich immer Englisch gesprochen, so dass er nicht vermutet, ich verstünde etwas Portugiesisch.
Der Mann im Wagen ist anscheinend Landwirt oder so. Die beiden vereinbaren, dass Immanuel morgen für ihn arbeiten wird und sich 10 Euro vorstrecken lässt. Der Fahrer zückt den gebügelt glatten 10-Euro-Schein, Immanuel händigt ihn mir zeremoniös aus, und als er mich zum Abschied umarmt, achte ich sehr darauf, meine Geldbörse festzuhalten.
Links: