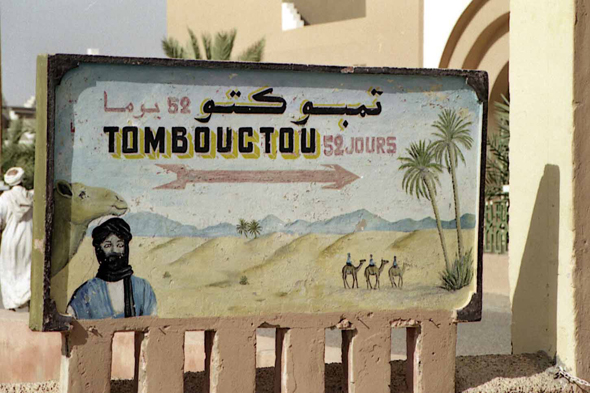Ich bin zur Zeit in Markkleeberg. Hier gibt es einige Seen, am schönsten und am größten den Cospudener See. An dessen Westufer fühlt man sich wie am Baikalsee, am Ostufer wie in den Hamptons, alles in einem etwa zweistündigen Seeumrundungsspaziergang zu erkunden, der, ob man will oder nicht, immer an einer Eis- und an einer Pommesbude vorbeiführt. Der verbleibende freie Wille des Menschen beschränkt sich auf die Frage, welche der Köstlichkeiten man als erste einnimmt.
Außerdem hat man die Aussicht auf überraschend viele Türme. Kirchtürme, Eiffeltürme, Fabriktürme, Bürotürme, Aussichtstürme, Burgtürme, Windräder und sogar Pyramiden.
Auf der Bistumshöhe gibt es einen, den zu erklimmen, um Euch die beste Aussicht zu präsentieren, ich mir vornehme.
Aber mir wird bald so mulmig zumute, dass ich von den 35 Metern maximal die Hälfte schaffe, zitternd ein paar Fotos knipse, und ohne längeren Aufenthalt wieder zur Erde zurückkehre, wo mein Herz noch immer gegen den vertikalen Ausflug protestiert. Der Job als Ausguck hoch auf einem Segelschiffmast, das wäre eindeutig nichts für mich. Ich würde ständig vor Angst die Augen schließen, und dann wäre Kolumbus doch glatt an Amerika vorbeigefahren.
Unter all den Türmen ragt in der Ferne einer heraus, der ziemlich dominierend, klotzig und fett erscheint. Das muss etwas ganz Besonderes sein. Mein Interesse ist geweckt.

Wie viele meiner ständig geweckten Interessen wäre dieses wahrscheinlich im Strudel der alltäglichen Ablenkungen und Banalitäten untergegangen, wenn nicht Ina, eine in Leipzig lebende Leserin dieses Blogs, mich angerufen und zu einem Besuch des Völkerschlachtdenkmals eingeladen hätte. Das ist schön, denn es zeigt, dass sie eine wirklich aufmerksame Leserin ist und meine Interessen richtig einschätzt. Manchmal laden mich Leute nämlich zu so Dingen ein, von denen jeder Mitlesende wissen müsste, dass ich davon nichts halte, wie Golftourniere, Hochzeiten oder Treibjagden.
Das Völkerschlachtdenkmal heißt im Volksmund „Völki“, aber kleiner oder niedlicher wird es dadurch nicht. Je näher man kommt, umso bombastischer wirkt es.
Wenn man es mir nicht anders gesagt hätte, so würde ich denken, hier wird der gefallen Sowjetsoldaten gedacht. Ansonsten baute ja nur die UdSSR so gewaltige Monumente in gewaltigen Parks.
Man kann die Größe gar nicht ermessen, wenn nicht ein paar andere Besucher zufällig ins Bild laufen, um die Proportionen zu illustrieren. Die mutigen Jugendlichen, die auf den riesigen Stufen herumturnen, erkenne ich nur durch den Einsatz eines Zooms, so hoch oben im Himmel befinden sie sich. Mit bloßem Auge sehen sie aus wie bunte Vögel, die in einer Reihe sitzen, um den Sonnenuntergang zu begutachten und Pläne für die nächste Zugvogelreise zu schmieden.
Aber Ihr wollt nicht nur staunen, sondern etwas lernen. Also will ich etwas zum Hintergrund erklären:
Im Jahr 1813 dachte man, dass Napoleon erledigt war. Gerade war sein Russlandfeldzug krachend gescheitert. Der Rückzug war schmerzlich und schmählich gewesen. Der einstige Kaiser musste sich als Autor von langweiligen Büchern wie dem „Code civil“ durchschlagen.
Dem armen Mann war langweilig. Also wollte er nach Leipzig fahren. Da war die Buchmesse und auch sonst allerhand los. Leider gab es damals noch keine Zugverbindung, weil die Leipziger den schönsten Bahnhof Europas bauen wollten, was halt ein bisschen dauert. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen.

„Noch keinen Bahnhof, aber den Fußballverein nach einer Lokomotive benennen? Das ist frech“, erregte sich Napoleon, der sich auf einem seiner Feldzüge die Cholerika eingefangen hatte.
Ab einem bestimmten Alter ist es schwer, alte Gewohnheiten abzulegen, also sammelte Napoleon eine Armee von 190.000 buchmessebegeisterten Soldaten ein und zog Richtung Leipzig.
Die anderen Staaten, allen voran Preußen, Russland, Österreich, Schweden und Großbritannien, hatten mittlerweile genug von Napoleon und verbündeten sich. Endlich. Das war praktisch die Geburtsstunde der NATO – und erklärt die spätere NATO-Skepsis in Frankreich. Ich habe jetzt leider kein Bild davon gefunden, aber in meiner Kindheit in den 1970er und 1980er Jahren war in der Tagesschau, wenn die NATO-Karte eingeblendet wurde, Frankreich immer schraffiert, weil es eben nur halbherzig dabei war. Damals konnte mir das niemand erklären, weshalb ich jetzt Geschichte studiere.
Aber zurück zu eben jener Geschichte: Man traf sich also vom 16. bis zum 19. Oktober 1813 in Leipzig, um die Sache auszufechten. Vier Tage mussten reichen, ein langes Wochenende, denn mehr Zeit würden die späteren Reenactment-Fritzen nicht aufbringen können. (Oder habt Ihr schon mal gehört, dass jemand die 162 Tage von Stalingrad nachspielt? Na gut, russische Schulkinder vielleicht, aber die haben ja eh einen Knall dort.)
Außerdem konnten sich die beteiligten Armeen mehr als vier Tage nicht leisten.
Damals wurde nur bei Tageslicht gekämpft, mangels Flutlicht und wegen den – insbesondere bei den Franzosen – starken Gewerkschaften. Abends mussten die Soldaten einquartiert und verköstigt werden. Für die Mannschaften genügte womöglich ein Zelt, die Niederländer (bis zu jener Vielvölkerschlacht von Frankreich besetzt) hatten sogar Campingwagen mitgebracht. Aber die Offiziere wollten ein Bett, ein Bad, einen Braten und eine Bouteille. (Daraus entwickelte sich das B&B-Business.)
Wer schon mal zu Kriegs- oder Messezeiten in Leipzig war, weiß, wie schnell die Betten knapp werden.
Damals war Leipzig noch ein wenig kleiner, so dass auf 40.000 Einwohner 555.000 Soldaten kamen. Nach vier Tagen waren einfach keine Lebensmittel – und vor allem keine Spirituosen – mehr da.

Außerdem hatten die vereinigten europäischen Alliierten gewonnen.

Napoleon war geschlagen und wurde nach Elba verbannt. Wobei sich „Verbannung“ schlimmer anhört, als es wirklich war. Napoleon durfte als Fürst über die ganze Insel herrschen und erhielt dafür jährlich zwei Millionen Francs. Ich will mich jetzt nicht vordrängen, aber dafür würde ich mich auch auf eine Insel im Mittelmeer setzen.

Aber zurück nach Leipzig, wo in jenen Oktobertagen im Jahr 1813 die bis dahin größte Schlacht der Weltgeschichte stattgefunden hatte. Ja, sogar bis heute – trotz zwischenzeitlichen zwei Weltkriegen – bleibt die Völkerschlacht das tödlichste Einzelereignis auf deutschem Boden, mit geschätzt bis zu 100.000 Toten. Nur in Dresden, der ewig zweiten Stadt hinter Leipzig, gibt es ein paar unverbesserliche Lokalpatrioten, die geschichtsverfälschend den Pokal des Massensterbens für sich beanspruchen.

Jedenfalls konnte man für so eine Riesensause keinen einfachen Gedenkstein aufstellen. Da musste schon etwas Bombastisches her!
Dabei gab es nur ein Problem: Leipzig liegt in Sachsen.
Und das Königreich Sachsen hatte, mit dem sicheren Gespür für historische Fettnäpfchen, zwar an der Schlacht von Leipzig teilgenommen – allerdings auf Seiten Napoleons. Der sächsische Ministerpräsident wich Fragen von Journalisten dazu zeitlebens aus, indem er auf „die Gefahren des Linksextremismus“ verwies.
Jahrzehntelang passierte nichts. Das ist eigentlich Standard in Deutschland, wenn man die Geschichte aufarbeiten müsste. Man lässt Gras über die Sache wachsen, wartet ein paar Generationen und konzentriert sich aufs Wirtschaftswachstum.
Und dann kam wieder ein Krieg, nämlich der von 1870/71. Deutschland gegen Frankreich, nur dass Deutschland erst entstehen musste, aber das war schließlich das Ergebnis jenes Krieges. Und diesmal gehörte sogar Sachsen zu Deutschland. „Das ist praktisch, das können wir später mal den Russen geben“, dachten sich die Hohenzollern und Wittelsbacher und wer sonst noch etwas im neuen Deutschen Reich zu sagen hatte.
Jedenfalls war es jetzt an der Zeit, große, stolze, monumentale Denkmäler im national-patriotischen Stil zu erbauen, und 1898 wurde der Grundstein für das Völkerschlachtdenkmal gelegt. 1913, zum hundertjährigen Jubiläum der Schlacht, wurde es eröffnet und versetzte ganz Deutschland in solch nationalen Taumel, dass die Nation wenige Monate später den Ersten Weltkrieg vom Zaun brach. Danke, Völki!
„Wir können auch hochgehen“, sagt Ina.
Ich suche noch nach einer Ausrede, die mich nicht vollkommen uncool aussehen lässt, aber da hat sie schon zwei Eintrittskarten erworben.
„Der Eingang ist beim Erzengel Michael“, sagt der Museumsmann, und ich muss zugeben, ich hätte den Türsteher nicht erkannt. Für mich sieht er eher aus wie Siegfried der Drachentöter oder sonst irgendein Mustergermane.
Überhaupt ist es ein interessanter Stilmix. Die Figuren sehr martialisch, kantig, muskulös. Viel mittelalterliche Symbolik mit Schwertern und Schildern und Ritterrüstungen. Aber die Reliefs in einer Mischung aus Jugendstil und sozialistischem Realismus avant la lettre.
Von außen sieht es so aus, wie wenn das ganze Denkmal aus vulkanischem Porphyrstein gemauert ist, der in der Abendsonne wunderbar rostbraun schimmert. Das wäre aber eine Riesenarbeit gewesen. Deshalb sind das Fundament und die tragenden Wände in Wirklichkeit aus schnödem Beton. Wie so ein Militärbunker, aber das passt ja zum deutschen Charakter, der hier gefeiert werden soll.
Trotzdem wurde so viel Granitporphyr ausgebuddelt, dass anderswo ganze Dörfer im Boden versanken.

Die Wände sind so dick, dass keine Handystrahlen durchdringen. Hier könnte man Abiturprüfungen durchführen, ohne dass die Kinder heimlich auf Wikipedia recherchieren. Denn dass die Abiturnoten immer besser werden, ist ja schon sehr verdächtig. (Außer für die jeweiligen Eltern natürlich, die alle überzeugt sind, dass ihre kleinen Racker Genies sind. Was die Frage aufwirft, wieso Genies nicht selbständig den Bus nehmen können, sondern von den Eltern in die Schule gefahren werden müssen.)
Die Statuen im Inneren stellen eine kuriose Kombination aus den Rittern der Tafelrunde, den zwölf Aposteln und Rübezahl dar.
Und immer höher geht es.

Insgesamt 500 Stufen. Die Wendeltreppe wird so eng, dass wir gerade noch durchpassen. Wenn man sich hier einen Döner mitbringt, um ihn ganz oben auf dem Monument zu verspeisen, würde man sich durch die Gewichts- und vor allem die Umfangszunahme den Rückweg versperren. So fordert die Völkerschlacht auch 200 Jahre später noch immer jährlich ein paar Tote.
Dafür hat man eine wirklich famose Aussicht. Auf der einen Seite über den „See der Tränen“ hinweg nach Leipzig, eine, wie einem aus der Vogelperspektive bitter bewusst wird, erschreckend ebene Stadt. Wie Las Vegas. Nur dass man in Leipzig zum Glücksspielen ins Bundesverwaltungsgericht geht.

Dafür gibt es auf der anderen Seite viel Grün, und das hebt die Stimmung gleich wieder.

Ganz in der Ferne das Kraftwerk Lippendorf, das die letzte Braunkohle verfeuert. In der Halbferne gemütliche Mehrfamilienhäuser. Und direkt zu Füßen des Völkerschlachtdenkmals ein Schloss in einem Wald.
„Was ist das?“ frage ich, total begeistert von dem An- und Ausblick.
„Das ist das Krematorium“, sagt Ina.
„Nein, ich meine nicht die rauchenden Schornsteine am Horizont, sondern das Schloss im Wald“, präzisiere ich.
„Ja, das ist das Krematorium“, erklärt Ina geduldig. Es gehöre zum Südfriedhof, dem größten Friedhof Leipzigs und gleichzeitig einem wunderschönen Park. Das merke ich mir, denn wie Ihr wisst, bin ich ein großer Fan von Friedhöfen, obwohl ich mir um das eigene Verscharren explizit kein Bohei wünsche.
Ganz viel Bohei gibt es hingegen im nahegelegenen Bruno-Plache-Stadion, woher der Wind den Schlachtenlärm, die Schmerzensschreie und die Jubelrufe einer Partie aus der Regionalliga Nordost trägt. Die Fans vom FC Lokomotive Leipzig haben einen Ruf als rechtsradikale Rowdys, aber 100.000 Tote an einem langen Wochenende, das schaffen sie dann doch nicht.

„Ist ja auch praktisch, dass der Friedhof gleich neben dem Schlachtfeld liegt“, kombiniere ich.
„Ich glaube nicht, dass das zusammenhängt“, sagt Ina. „Der Friedhof wurde erst 70 Jahre nach der Schlacht eröffnet.“
„Und wo sind dann die Gräber der 100.000 Soldaten?“
„Das weiß ich gar nicht“, wundert sich Ina selbst.
Wenn Leute, die sonst alles wissen, plötzlich Nichtwissen vorschützen, dann ist das verdächtig. Weil wir noch immer hoch oben auf dem schwindelerregenden Turm stehen, sage ich erst einmal nichts, nehme mir aber vor, der Sache gewohnt gründlich nachzugehen.
Die örtliche Presse meldet alle paar Jahre den Fund eines „Massengrabs“, wobei bisher insgesamt nur 200 Skelette gefunden wurden. 200 Tote, das sind nun wirklich keine Massen, insbesondere nicht bei so einer Jahrhundertschlacht. So viele Menschen sterben im impfskeptischen Sachsen ja schon allein jeden Tag aus Angst vor der Spritze. Und wo sind die anderen 999.800 Toten? Ganz offensichtlich soll hier etwas vertuscht werden.
Dabei zeigen historische Aufnahmen, dass die toten Soldaten, Pferde und Militärkatzen in Leipzig liegen gelassen wurden. Das war damals normal, weil die Armeeführung oft gar nicht wusste, wie die einzelnen Soldaten hießen oder woher sie kamen. Es gab noch keine Wehrpflicht, die Jungs waren einfach in irgendwelchen Spelunken (zwangs)rekrutiert worden. Mit dem Ende der Schlacht wurden sie entlassen und gingen nach Hause. Oder nach Südamerika, um für Simon Bolívar zu kämpfen.

Außerdem gab es noch kein Wahlrecht, so dass sich die Kaiser und Generäle für das gemeine Volk sowieso nicht interessierten. Und Kühltransporter für den Abtransport der Leichen waren auch noch nicht erfunden worden.
Stattdessen war es Brauch, dass die örtliche Bevölkerung die Toten vergrub. Teils aus Pietät, teils weil sie dazu gezwungen wurde, und natürlich zur Prävention von Seuchen. Einen guten Dünger gaben die Soldaten auch ab. Weil die Leipziger sie vorher durchgefüttert hatten, musste deshalb niemand ein schlechtes Gewissen haben. Und wenn man beim Leichenverbuddeln noch einen Säbel, ein paar Stiefel oder eine Schnupftabakdose abstauben konnte, umso besser. Schließlich war Leipzig Messestadt, da konnte man den Touristen allerhand echte und gefälschte Schlachtensouvenirs verkaufen.
Einmal im Monat könnt Ihr auf dem Agra-Flohmarkt in Markkleeberg auch heute noch Orden, Stahlhelme, Fahnen, Soldbücher, Wehrmachtsdolche u.s.w. erwerben. Überhaupt ist das ein fantastischer Trödelmarkt, sehr zu empfehlen! Ich weiß gar nicht, wieso Leute zum moralisch sehr fragwürdigen IKEA laufen, wenn sie hier stilvolle Möbel aus dem VEB Möbelkombinat kaufen können, für die keine Bäume mehr abgeholzt werden müssen. (Die IKEA-Möbel kamen ja sowieso aus der DDR.)


Aber ich will hier nicht abschweifen, insbesondere nicht nach Schweden, denn dorthin bin ich schon einmal abgeschweift oder abgeschwiffen, was zwar zum Schreiben lustig, aber zum Lesen mühsam ist, und uns außerdem weit weg vom eigentlichen Thema brächte, das da wäre – jetzt muss ich selbst kurz nachsehen -, ach ja, die Gefallenen der Völkerschlacht.
Ab 1819, also sechs Jahre nach der Schlacht, tauchten in den Zeitungen des europäischen Kontinents plötzlich massenweise Annoncen britischer Händler auf, die händeringend nach Knochen suchten. Sie verkündeten, dass sie alles Knochenmaterial aufkaufen würden, ohne Mengenbeschränkung und zu guten Preisen. Wegen der Nähe zu den Seehäfen wurden diese Anzeigen hauptsächlich in Norddeutschland, in den Niederlanden und in Frankreich geschaltet. Leipzig liegt bekanntlich nicht am Meer, aber der Knochenhandel schien so vielversprechend, dass die Leipziger begannen, einen Kanal zum Meer zu graben. (Wie mir das bei meiner eigentlich umfassenden Geschichte des Kanalbaus entgehen konnte, ist ein unverzeihliches Rätsel.)

Das tolle am Knochenhandel war, dass er unreguliert war. Es gab keine Ausfuhrsteuern, keine Einfuhrsteuern, keine Zölle. Es gab nicht einmal EU-Richtlinien oder -Verordnungen, die den Handel mit Knochen regulierten. (Deshalb waren die Briten damals noch glücklich.) Insbesondere für die Armen auf dem Kontinent war das eine lukrative Einnahmequelle. (Mitlesende FDP-Politiker ärgern sich jetzt, diese Information zu spät für die Verhandlungen über die Reform des Bürgergeldes erhalten zu haben.)
Die Bauern um Leipzig fanden es zudem nur fair, die Knochenberge wieder auszugraben und zu Geld zu machen. Schließlich hatten ihnen diese verfluchten Armeen 1813 die ganze Ernte zertrampelt und den Wein weggesoffen, so wie später alljährlich die Reenactment-Veranstaltungen.
Zu DDR-Zeiten hieß es natürlich nicht „Reenactment“, sondern „historische Darstellung in originalgetreuen Uniformen zum Zwecke der Traditionspflege“. Dass es so etwas während der deutschen Teilung im Osten gab, hat mich als Wessi überrascht. Aber insofern ist das Völkerschlachtdenkmal ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man an einem Bauwerk im Laufe der Zeit die unterschiedlichsten, teils konträren Geschichtsbilder festmachen kann.
Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wollte der neue antifaschistische Staat das Völkerschlachtdenkmal natürlich sprengen, wie so vieles andere in Leipzig und anderswo. Aber der 300.000 Tonnen schweren Klotz ließ sich nicht sprengen, zumindest nicht mit konventionellen Mitteln. Also entwickelte die DDR eine Atombombe. (Das war vor dem Atomausstieg und zu einer Zeit, als man die Gefahren der Kernkraft gerne verniedlichte.) Es war schon alles in die Wege geleitet, die Evakuierung der Stadt geplant, die Fernsehkameras bereit, als – praktisch in letzter Minute – 1954 der Film „Godzilla“ in die Kinos kam und sehr plastisch vor den Gefahren des Atommissbrauchs warnte.

Auf der Suche nach einem Ausweg, der ohne ein zerstörerisches Krümelmonster auskäme, meldete sich ein kreativer Historiker im Politbüro mit der Lösung: Man würde das Völkerschlachtdenkmal stehenlassen, aber einfach anders interpretieren. Der preußisch-russische Sieg von 1813 war plötzlich das Vorbild für die deutsch-sowjetische Waffenbrüderschaft (die ja doch eher eine Pipeline-Brüderschaft war). Die germanischen Ritter waren sozialistische Helden. Napoleon war ein westlicher Imperialist, den man gemeinsam besiegt hatte.
DDR-Briefmarken würdigten nicht nur das eigentlich deutsch-nationale Völkerschlachtdenkmal, sondern auch den preußischen Generalfeldmarschall Fürst Blücher von Wahlstatt, den preußischen Feldmarschall Graf Neidhardt von Gneisenau, den preußischen General von Scharnhorst und das Lützowsche Freikorps – in den Reihen „Nationaler Befreiungskampf 1813“ und „Deutsche Patrioten“.






Vielleicht war die DDR das deutschere, ja das preußischere Deutschland?
Ich habe mich schon immer gefragt, wieso die Züge in der DDR unter der Marke „Deutsche Reichsbahn“ fuhren. Und Besucher aus aller Welt berichteten nach einem Besuch in der DDR sehr verstört von mit Stechschritt zur Schau gestelltem Militarismus, absurderweise vor dem „Mahnmal für die Opfer des Faschismus und Militarismus.“
Halt, das war das falsche Video.
Hier das richtige, aber die Ähnlichkeit ist verblüffend, oder? Ebenfalls verblüffend ist die Ähnlichkeit zu dieser bolivianischen Schulband, aber das ist jetzt wirklich ein anderes Thema.
Im Westen gab es so etwas nicht. Da waren ja alle Hippies und in Woodstock. Und wenn einer zur Bundeswehr ging, dann eigentlich nur, um einen gefütterten Parka für die damals noch kalten Winter abzustauben.

Das war so gang und gäbe, dass man mit der Ausstattung am ersten Tag schon Formularvordrucke für Verlustmeldungen in die Hand gedrückt bekam. Den Parka „verlor“ eigentlich jeder mindestens einmal in seiner Soldatenlaufbahn, dazu gerne die langen Unterhosen und das Kochgeschirr aus stabilem Blech. Ehrlich, mich wundert gar nicht, dass es jetzt bei der Bundeswehr enormen Materialmangel gibt.
Ich selbst habe nichts mitgehen lassen. Ich bin gar nicht erst hingegangen. Das war allerdings nicht mehr in Westdeutschland, sondern schon im wiedervereinigten Deutschland. Apropos Wiedervereinigung: Vielleicht ist am höheren Nazi-Anteil in Ostdeutschland doch nicht die Treuhand schuld, sondern der „unverkrampfte“ Umgang mit Nation und Deutschtum, den die DDR pflegte?

Am jährlichen Nachspielen der Völkerschlacht störte die Stasi auch nicht das Waffenklirren oder der Pulverdampf, sondern dass dazu Teilnehmer aus Westeuropa anreisten. Ein Franzose wollte für das Reenactment 1983 sogar ein „historisches Schussgerät“ einschmuggeln. Und die Belgier zerstörten „nach größerem Alkoholkonsum“ die Einrichtung einer Gastwirtschaft, wo übrigens, das immerhin sei zur Ehrenrettung der DDR gesagt, der Bismarckhering als „Delikatesshering“ verkauft und verzehrt wurde.
Aber zurück zum Thema: Was zum Teufel wollten die Briten mit all den Knochen?
Dazu muss man wissen: Knochen enthalten Phosphat. Und Phosphat ist ein guter Dünger.
Jahrhundertelang hatten die Briten (und viele andere Völker) die Felder dadurch gedüngt, dass sie ihre Nachttöpfe auf dem Acker ausleerten, um das möglichst wenig unappetitlich zu beschreiben. Wer auf dem Land wohnt, kennt das ja, Gülle, Jauche, das ganze eklige Zeug. Nun ergab es sich aber zu jener Zeit, dass die Industrielle Revolution die Menschen in die Städte lockte. Die Landflucht führte nicht nur dazu, dass es teilweise an Arbeitern für die Bewirtschaftung der Felder mangelte, sondern eben auch an menschlichem Dünger.
Deshalb die panische Suche nach Knochenmaterial.
Natürlich wollten die Händler eigentlich Pferde-, Rinder- und Walfischknochen. Aber zur Not tut’s auch ein Preuße oder ein Franzose. So genau sieht niemand hin, und es wird ja sowieso alles zu Knochenmehl zermalmt.
Das ging ein paar Jahre gut. Aber wie das immer so ist bei neuen Geschäftsfeldern, bald kommt die Regulierung. Es wurden Ausfuhrzölle erlassen. Es wurden Gesundheitsschutzvorschriften erlassen, nach denen die Zwischenlagerung von Knochen in der Wohnung verboten war. Und schließlich wurde das Öffnen von Gräbern verboten. (Zumindest von europäischen Gräbern. In Ägypten durfte man natürlich weiter graben, was das Zeug hielt. Deshalb leiden wir noch immer unter dem Fluch des alten Tutanchamun.)
Zu allem Überfluss wurde auch noch ein besserer Dünger entdeckt, nämlich Salpeter. Der kam aus der Wüste in Chile, aus der Stadt Humberstone, die ich bereits für Euch besucht habe.


An dem Tag wäre ich übrigens fast verdurstet. Die Atacama-Wüste ist wirklich so trocken, wie man immer hört. Irgendwann bringt mich das noch um, dass ich immer alles selbst überprüfen will. So wie damals in Bolivien, als ich testen wollte, wie sich Höhenkrankheit anfühlt. Oder wie in Montenegro, wo ich in dunkle Schächte kletterte und in einem geheimen U-Boot-Hafen herauskam. Mal sehen, was mir als Nächstes einfällt.
Aber zurück zu den Knochen. An die Stelle der britischen Landwirtschaft trat ab den 1830er Jahren die Zuckerindustrie als Großabnehmer für Skelette aller Art. Und jetzt wird es wirklich fantastisch, wie Politik, Kriege, Wirtschaft, Landwirtschaft, Wissenschaft und überhaupt alles zusammenhängt. Deshalb macht Geschichte so Spaß!
In Europa wurde ursprünglich kein Zucker produziert. Aller Zucker kam von den Zuckerrohrplantagen in der Karibik und aus anderen Kolonien, weswegen Zucker nicht nur schlecht für die Zähne, sondern auch verantwortlich für die Sklaverei ist. Im Rahmen der kleinen Auseinandersetzung, an deren Ende die Völkerschlacht stand, verhängte Napoleon 1806 die sogenannte Kontinentalsperre, eine Wirtschaftsblockade gegen Großbritannien und dessen Kolonien. Importierter Rohrzucker wurde unerschwinglich teuer.
Dummerweise hatten sich die Menschen in Europa schon an Zucker gewöhnt. (Macht ja schließlich süchtig, dieses Teufelszeug.) Also gingen findige Forscher daran, ein Substitut zu finden. Die deutschen Lebensmittelchemiker Andreas Sigismund Marggraf, Franz Carl Achard und Carl Scheibler experimentierten mit verschiedenen Rüben und veredelten die Runkel- schließlich zur Zuckerrübe. So profane Themen schleckten wir in der BRD ab, wenn wir eine Postkarte verschicken wollten. Da war nichts mit Patriotismus und nationalem Befreiungskampf.

Also wurden überall, wo es der gute Boden erlaubt, Zuckerrüben angebaut und zu Sirup gepresst. Um daraus den raffinierten weißen Zucker zu generieren, auf dem die verwöhnte Kundschaft besteht, muss man diesen jedoch filtern. Und diese Filterung geschieht mit – Ihr habt es schon geahnt – Knochenkohle. Die Zuckerindustrie benötigte massen- und tonnenweise Knochen, damit der Zucker rein und weiß aussieht.
Dass die Fabrik der Südzucker AG in Zeitz errichtet wurde, nur 40 km vom Ort der Völkerschlacht entfernt, war also kein Zufall. Überhaupt deckt sich die Karte der Zuckerrübenanbaugebiete und der Zuckerfabriken verdächtig mit den Orten großer Schlachten. (Das ganz im Westen ist wohl der Hürtgenwald, daran traf Napoleon ausnahmsweise keine Schuld.)
Wie Horaz schon sagte: „Süß ist es, fürs Vaterland zu sterben.“
Und jetzt wisst Ihr, warum der Puderzucker auf dem Leipziger Stollen immer so schön fein und weiß ist. Darüber, welche Knochen der Kinderschokolade ihren Namen gegeben haben, denkt man besser gar nicht nach.

Tut mir leid, falls ich Euch jetzt den Appetit verdorben habe. Ich selbst bin durch die lange Befassung mit diesem Thema abgehärtet und nehme etwaige Restbestände an Stollen und Schokolade gerne entgegen!
Links:
- Eine ähnliche Situation liegt in Waterloo vor, wo sogar heute noch Zuckerrüben im Schlachtfeld wachsen. So pietätlos immerhin sind die Leipziger nicht.
- Der großartige Jaroslav Hašek hat die Verbindung zwischen Soldatengebeinen und der Zuckerfabrikation schon vor 100 Jahren, im „Schwejk“, öffentlich gemacht. Aus unerfindlichen Gründen wurde diese Veröffentlichung von 1923 in der Kriegsgräberforschung überhaupt nicht rezipiert. Aber dafür stellt sich dieser Blog furchtlos an die Speerspitze der Forschung.
- Weitere appetitanregende historische Enthüllungen.
- Die Website des Völkerschlachtdenkmals.