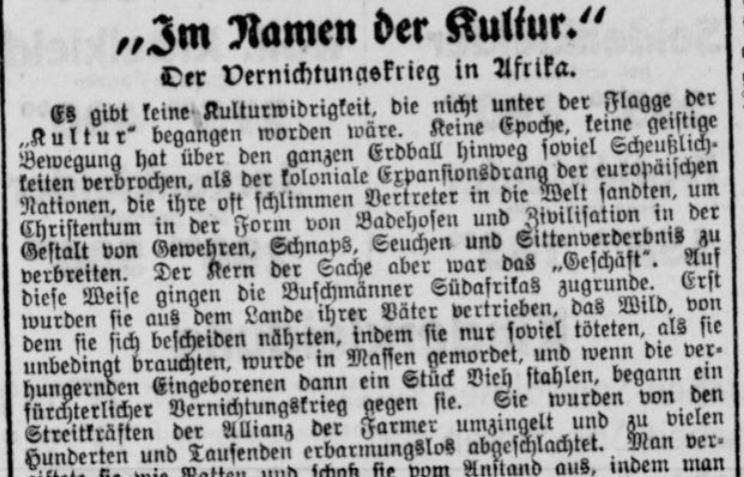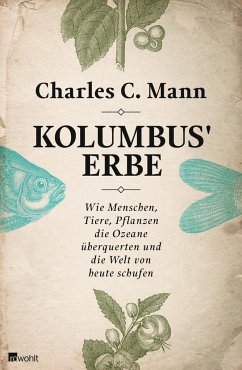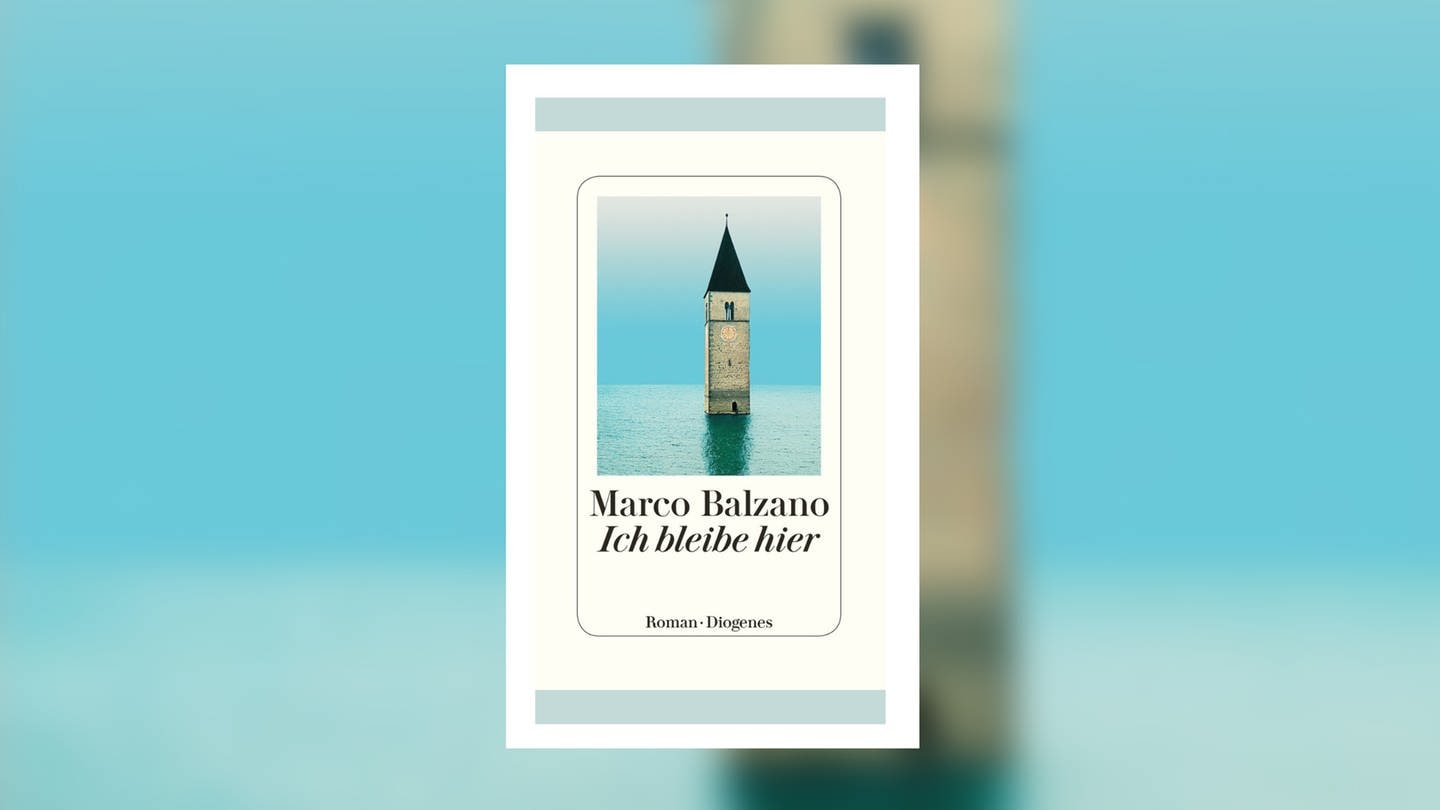To the English version of this story.
Ich habe schlecht geschlafen. Fast überhaupt nicht. Obwohl ich ständig auf Reisen bin, auf fünf Kontinenten in 64 Ländern – oder umgekehrt – war, schlafe ich noch immer schlecht, wenn am nächsten Morgen die große Reise losgeht. Umso mehr, wenn ich in unbekannte Gefilde muss. Ich stehe vor meiner ersten Reise nach Skandinavien.

Außerdem konnte ich nicht einschlafen, weil ich den großen Fehler beging, spätabends noch bei Facebook und Twitter reinzusehen. Von ersterem erfuhr ich vom Tod einer Freundin in Bolivien, von zweiterem vom blitzkriegartigen Vormarsch der Taliban in Afghanistan. Vielleicht hat die Bundeswehr aus Versehen die falsche Seite ausgebildet, ausgerüstet und aufgebaut?
Mein Ratschlag, zwei Stunden vor dem Einschlafen keine E-Mails, kein Facebook, kein Twitter, keine Nachrichten, eigentlich gar nichts mehr mit Bildschirmen zu konsumieren, sondern das Gehirn in dieser Zeit nur mehr mit Literatur zu verwöhnen, bleibt trotz punktueller Nichtbefolgung gültig. Überhaupt hängen gute Ratschläge nicht von der Person des Ratgebers ab. Wenn ein Raucher sagt, Rauchen sei ungesund, und ein Nichtraucher sagt, Rauchen sei gesund, hat der Raucher trotzdem Recht. Aber in Zügen darf man gar nicht mehr rauchen, glaube ich.
So meine wirren Gedankengänge, als ich um 4:17 Uhr unausgeschlafen am Bahnhof von Sulzbach-Rosenberg stehe.
Es ist erstaunlich warm an diesem sehr frühen Augustmorgen, und ich bin nicht einmal der einzige Passagier, der auf den ersten Zug des Tages Richtung Nürnberg wartet. Es ist ein ganz besonderer Zug. Nämlich der erste nach Beendigung des Bahnstreiks um 2 Uhr, wie mich ein asiatisch aussehender Mann aufklärt. Er habe deshalb die letzten zwei Tage zuhause bleiben müssen. Kein Home-Office. Er arbeitet nämlich etwas richtiges, nicht so einen Sesseljob, den man von überall aus erledigen kann. Mich wundert immer, wie viele von den Sesseljobbern nicht in ein Land oder zumindest eine Region mit günstigeren Lebenshaltungskosten ziehen. Das ist doch Unsinn, in München oder Hongkong Miete zu zahlen, wenn man auch von Pilsen oder Dniepropetrowsk aus e-mailen könnte.
„Wegen der Kinder“, sagen die Leute dann, und ich frage mich: „Was haben die Kinder davon, dass Ihr Euch krumm und bucklig schuftet, um den Vermieter reicher zu machen?“ Außerdem, wenn Ihr Euer Leben kaputt machen wollt, geht das auch ohne solche CO2-Schleudern in die Welt zu setzen. Und ich muss jetzt Zug fahren, damit wir das Pariser Klimaabkommen noch erfüllen können. Naja, im Moment wäre ich sowieso zu müde zum Autofahren. Früher, als ich noch ein Auto hatte und viel und weit gefahren bin, musste ich manchmal anhalten und eine Stunde schlafen. Einmal wäre ich fast erfroren dabei. Aber das war wahrscheinlich nicht im August. Früher war es aber auch kälter. Eben wegen des Klimawandels. Und so hängt alles mit allem zusammen.
Er arbeite in einem Getränkemarkt, sagt der Mann am Bahnsteig.
„Und da müssen Sie so früh anfangen?“ frage ich entsetzt.
„Nein, aber vom Bahnhof in Hersbruck muss ich noch ein paar Kilometer laufen.“
Ich blicke in den dunklen Nachthimmel und denke mir, dass ein Spaziergang zu so früher Stunde gar keine schlechte Art ist, den Tag zu beginnen. Zudem schläft man so abends sicher besser ein.
Als reisender Reporter sollte ich immer wach sein, immer Gespräche anzetteln oder Telefonate belauschen, aus dem Fenster beobachten, kombinieren und beschreiben. Aber alle Leute im Regionalexpress nach Nürnberg fahren zur Arbeit und schlafen. Draußen ist es noch stockdunkel.
Außerdem: Ich kann nicht zweieinhalb Tage wachbleiben. Und lieber schlafe ich jetzt als wenn wir die Öresund-Brücke überqueren oder Rentiere vor den Fenstern vorbei galoppieren, so sie die deutsche Fünfkampf-Trainerin noch nicht totgeprügelt hat. Das war jetzt eine allzu aktuelle Bemerkung und noch dazu eine, die diejenigen, die, und darüber sei niemandem ein Vorwurf zu machen, die Sportberichterstattung von den Olympischen Pandemiespielen in Tokio nicht verfolgt haben, nicht einmal ein müdes Lächeln zu entlocken vermag.
Apropos müde, das bin ich immer noch, deshalb werden die Gedanken zusammenhangloser und die Sätze länger. Wer die bereinigte Fassung lesen will, muss auf das Buch warten. Wobei es von dieser Reise keines geben wird, dazu ist sie zu unspektakulär. Samarkand statt Stockholm, Seidenstraße statt Schweden, ja das wäre was! Schade, dass man jetzt nicht mehr nach Afghanistan fahren kann. Ein lange gehegter Traum, den ich zu lange gehegt anstatt ausgelebt habe.
Nach Nürnberg steigt Nebel von den Wiesen auf, noch bevor die Sonne über den Horizont lupft. Babys fangen an zu brabbeln. Es wird echt Zeit, dass sich die Klimadiskussion auf diese kleinen CO2-Emittenten fokussiert.
Schon in Erlangen ist der Zug rappelvoll. Der Streik hat die Bahn anscheinend keine Sympathien gekostet. So interessante Geschichten wie auf der eisenbahnlichen Kanada-Durchquerung sind im ICE durch Deutschland nicht zu sammeln. In Deutschland erzählt dir keiner die Lebensgeschichte. Hier wird entweder wichtig getan oder mürrisch geguckt.
Am schlimmsten sind die Spießer, die einen bestimmten Sitzplatz reservieren und dann andere Passagiere aufwecken, anblaffen und verscheuchen. Ich weiß nicht, was das soll. Es gibt Sitze für jeden. Sogar im Flugzeug habe ich noch nie gesehen, dass jemand stehen muss. Außerdem macht es doch viel mehr Vergnügen, durch den Waggon zu spazieren und sich neben den am sympathischsten oder interessantesten erscheinenden Mitreisenden zu setzen. Ich setze mich zum Beispiel gerne zu Leuten, die Bücher lesen. Die Reservierungsfetischisten sind so doof, die setzen sich sogar direkt hinter ein Baby, nur weil die Nummer auf dem Ticket steht. Und auf der Suche nach der Nummer schleppen sie ihren Koffer durch den ganzen Zug, anstatt den ihnen nächstliegenden Platz zu okkupieren.
Gepäck ist auch nervig. Früher hatten die Züge dafür einen extra Waggon, so dass es nicht die Flure und Sitze vollstellte. Zwischen Sucre und Potosí, in Bolivien, gibt es einen Zug, bei dem das Gepäck mit einem zu einer Draisine umgebauten Dodge-Pick-Up vorausgeschickt wird und entsprechend den Adressaufklebern auf die Hotels und Häuser verteilt wird. Wenn die Passagiere nach Potosí kommen, steht der Koffer schon im Schlafzimmer.

Zugegeben, das war lange her und die Draisine steht jetzt im inoffiziellen Eisenbahnmuseum in Sucre, zu dem Euch der Stationsvorsteher Miguel mit einem großen Schlüsselbund Zutritt verschafft, wenn er an dem Tag nichts zu tun hat, was, als ich in Sucre war, zum Glück oder Unglück der Fall war, weil die Brücke zwischen Sucre und Potosí eingestürzt war. In Sucre wurde übrigens der Zebrastreifen erfunden. Und Potosí war mal die reichste Stadt der Welt. Ist aber nicht mehr viel übrig davon, ich habe nachgeschaut.
Wenn ich müde bin, aber nicht einschlafen kann, komme ich leicht ins pausen- aber zusammenhanglose Erzählen. Das erste Mal wurde mir das im Pfadfinderlager bei Luminy, außerhalb von Marseille, bewusst. Die ganze Gruppe lag in einem Zelt, denn Zeltaufbau erfordert Ressourcen, die wir lieber der Waldbrandbekämpfung widmeten, wofür wir schließlich von den französischen Pfadfinderkollegen und -kolleginnen eingeladen worden waren. Diese Erfahrung verschaffte mir viel später die Gelegenheit, brasilianischen Feuerwehrleuten bei der Bekämpfung von Waldbränden im Nationalpark Chapada Diamantina zu helfen. Nachdem ein anderer Feuerwehrmann verlustig gegangen war, durfte ich beim Rückflug nach Lençois sogar dessen Platz im Helikopter einnehmen. Das war wie bei „Black Hawk Down“. Bahia, der brasilianische Bundesstaat, sieht ja auch aus wie Somalia.
Jedenfalls kann ich nicht leicht einschlafen, wenn ich mit anderen Leuten im Zimmer, im Zelt, in der Zelle oder im Zug bin. Ich weiß nicht, was das Problem ist, denn ich habe keine Angst, dass mich jemand beklaut oder ermordet. Im Zelt im südfranzösischen Zedern- und Zypressenwald machte mich die Insomnia ganz hyperaktiv, und ich begann zu erzählen. Ganz unterhaltsam anscheinend, vielleicht sogar lustig, denn bald war der ganze Trupp alkoholisierter Pfadfinder wach vor Begeisterung. Oder vor Überraschung, weil ich bis dahin immer ruhig und schüchtern gewesen war und keinerlei Talent zum Late-Night-Entertainer gezeigt hatte. Das muss vor genau 30 Jahren gewesen sein, denn wir lauschten damals auf Kurzwelle gespannt den Nachrichten aus Moskau, von dem uns bekannten Gorbatschow, dem uns noch unbekannten Jelzin, den Panzern vor dem Parlament, und schließlich den Bürgern auf den Panzern. Währenddessen spann der uns damals vodka-absolut unbekannte Putin in Dresden seine ersten kriminellen Fäden. Der Absolut-Vodka kommt übrigens gar nicht aus Russland, sondern aus Schweden.
Aber das hat jetzt nichts mehr mit der Eisenbahn zu tun. Obwohl, doch: Denn nach Marseille fuhren wir mit dem Zug. Damals dachte man noch, Ausland sei gefährlicher als Inland. Irgendwie hatte sich die Geschichte verbreitet, dass in Frankreich Banditen ins Abteil kämen und die schlafenden Passagiere mit KO-Tropfen bestäuben und sie sodann ausrauben würden. Anstatt uns zu fragen, wer so blöd wäre, Pfadfinder zu beklauen, hielten wir abwechselnd Wache. Nach Marseille bin ich später übrigens noch einmal gefahren, zu einem Vorstellungsgespräch. Hat aber nicht geklappt.
Nördlich von Coburg zieht ein Heißluftballon durch den Morgenhimmel. So ein Bahnstreik macht die Leute kreativ. Ich bin zu müde zum Fotografieren. Nur Schreiben geht immer. Naja, Ihr seht ja, was für ein Gonzo-Quark dabei raus kommt. Immerhin ist mein Quark konsequent linksdrehend. Oder dreht nur Joghurt? Ganz ehrlich, ich konnte da nie einen Unterschied schmecken. Und wenn man den Becher auf den Kopf stellt, dreht er plötzlich andersrum, oder was? Und was, wenn man den Joghurt auf die Südhalbkugel mitnimmt? Angeblich fließt da auch das Wasser andersrum in den Abfluss. Ich habe ein paar Jahre auf der Südhalbkugel gelebt, aber das habe ich nie überprüft. Interessiert doch auch niemanden, solange der Abfluss überhaupt funktioniert. In Bolivien war eher der Zufluss das Problem. Manchmal gab es ein paar Tage kein Wasser. Kennt Ihr vielleicht aus dem Film „Quantum of Solace“. Ist aber ne echte Geschichte. So ungefähr wie in dem Filmausschnitt sieht der oben erwähnte Bahnhof von Sucre aus. Immerhin der Hauptstadt Boliviens. Nein, das ist nicht La Paz. Schaut doch nach, wenn Ihr es nicht glaubt: Artikel 6 Absatz 1 der bolivianischen Verfassung. Die Verfassung zu lesen, sollte eigentlich dazu gehören, wenn man ein Land kennenlernen will. Aber naja, ich mache mir die Mühe, damit Ihr es nicht tun müsst.
In Leipzig wird sogar dem Kapitän die Reservierungsraserei zu bunt. Ganz freundlich sagt er durch: „Nehmen Sie einfach den nächstgelegenen Platz. Jeder Sitz ist genauso bequem wie die anderen.“ Danach rast er mit 200 km/h durch die Landschaft, aber es bleibt bequem. Schon toll, so ein Zug. Im Auto hingegen bekommt man bei 200 km/h Panik. Vor kurzem fuhr ich per Anhalter von Italien nach Deutschland zurück. Auf der A6 nahm mich ein junger Mann mit, der so schnell, unvorsichtig und aggressiv fuhr, dass ich an der nächsten Raststätte wieder ausstieg, obwohl er weiter in die gewünschte Richtung fuhr.
Lutherstadt Wittenberg, das ist so eine Namenskombination, die ich immer mit dem ICE verbinde. Genauso wie Kassel-Wilhelmshöhe oder Berlin-Gesundbrunnen. An jeder Station steigen mehr Leute ein als aus. Das kann nicht immer so weitergehen, weder linear, noch exponentiell. Erst am Hauptbahnhof in Berlin wird sich das Verhältnis umkehren. Ein beliebtes Städtchen, anscheinend. Aber hässlicher Bahnhof. Im Keller, wie ein Bombenbunker. Selbst die tatsächlich zerbombten Bahnhöfe in Nürnberg und Leipzig wurden wieder schön und grandios, wie es der Bahn als dem besten Verkehrsmittel aller Zeiten angemessen ist, wieder aufgebaut.

Einen der Klapptoptypen, der laut herumposaunt hat, dass er IT-Mensch ist und deshalb dringend und wichtig nach Hamburg muss, um dort etwas zu kalibrieren, installieren, rekonfigurieren oder desinfizieren, ereilt die gerechte Strafe, als die ihm gegenüber sitzende Oma ihr Handy herausholt und ihn bittet: „Wenn Sie in IT machen, können Sie mir mal mit meiner Corona-App helfen?“
Salat hilft noch mehr gegen die Müdigkeit als Coca-Cola. Das Problem bei meiner Müdigkeit ist, dass das Gehirn noch schneller läuft. Wie wenn der müde Körper es nicht mehr im Zaum halten kann. Ich komme kaum mit dem Schreiben mit. Gut, dass das später niemand lesen muss. Heinrich Schliemann hat seine Notizen übrigens immer in der Sprache des Landes aufgeschrieben, in dem er gerade war. Aber damals waren ja auch die Züge langsamer. Außerdem sprach er dreißig Sprachen, und ich nur drei. Aber ich glaube, das war auch so ein Karl-May-Typ. Karl May, nicht Karl Marx. Den Jüngeren muss man erklären, wer das war. Oder liest den noch jemand?
Paare finden es anscheinend vollkommen normal, nebeneinander zu sitzen und jeweils in einen separaten Bildschirm zu glotzen. Oder sie sind auf dem Rückweg von der Hochzeitsreise, und die Beziehung ist eh schon kaputt.
Nach Berlin ist Deutschland vollkommen flach, wie geschaffen für Panzerschlachten. (Je langweiliger das Terrain, umso mehr entscheiden Technik und Taktik.) Schade, dass sich die Reenactment-Gruppen nicht an so etwas wagen, sondern nur mit ihren Holzschwertern rumkloppen. Was ja auch meist nur ein einstündiger Vorwand ist, um sich anschließend den ganzen Abend die Wampe vollzuschlagen. Von den Hungersnöten im Mittelalter haben die Typen anscheinend noch nie gehört.
Selbst hier, wo es nicht viel zu sehen gibt, fährt der Zug viel zu schnell für meinen Geschmack. Die kleinen Bahnhöfe, die verfallenen Kolchosen, die Windmühlen, überall würde ich gerne aussteigen, um zu erkunden. Wenn der Zug mal kurz stehen bleibt, ertönt eine entschuldigende Durchsage. Wie wenn es schlimm wäre, den Schafen auf der Weide zuzusehen. Besser als der Weidel beim Schaffen zuzusehen. Anstatt Schafzucht machen die Leute hier aber jetzt mehr in Windenergie, wie es aussieht. Soll mir recht sein, Lammfleisch ist nicht mein Ding. Nicht meine Tasse Tee, wie der Engländer sagt, aber was nutzt das denen, die sich nichts aus Tee machen? Schweife ich ab? Nicht mehr als sonst? Okay, dann ist ja gut.

Außerdem steige ich jetzt um, damit mal ein bisschen Abwechslung reinkommt. Hamburg Hauptbahnhof. Viel zu klein für die vielen Leute. Ich kann nicht sagen, was das für die Stadt bedeutet, weil ich nicht weiß, ob die Menschen ankommen oder weg wollen.
Der Zug nach Flensburg ist jedenfalls voll wie eine Sardinendose. Fährt ja auch zum Meer. Ich bekomme nur einen Platz neben der Toilette. Zwei Stunden lang Tür auf, Tür zu, strunz, pinkel, blubber, Spülung, Tür auf, Tür zu. Da müsste selbst ein Stein aufs Klo, wenn er das immerzu hörte. Macht die Toilette halt schalldicht, liebe Deutsche Bahn AG. Aber wahrscheinlich ist die gar nicht zuständig dafür, sondern irgendein Tochterunternehmen. DB Rail Passenger Sanitary Services GmbH & Co KG oder so. Verschachtelt wie bei den Panama Papers. Durch Panama fährt übrigens auch ein Zug. Vom Pazifik zum Atlantik. Oder umgekehrt. Je nach Tageszeit. Da war ich aber noch nicht. Müsste ich mal hin. Vielleicht, der Gedanke kam mir schon oben bei der bolivianischen Eisenbahn, für ein Buch über Eisenbahnen in Süd- und Mittel-, also Lateinamerika. Nicht so ein langweiliges Eisenbahnbuch über Lokomotiven und Spurweiten, sondern etwa so wie meine Trilogie über die Kanada-Durchquerung. Gespräche mit den Menschen im Zug. Gedanken über die völkerverbindende Eisenbahn. Interessante Zwischenstopps. Banditenüberfälle. Naja, was einen selbst interessiert, interessiert meist niemand anderen. Deshalb sind die Zeitungen voll mit Fußball und Bitcoin, und meine Geschichten will niemand drucken. Deprimierend ist das.
Ein sehbehinderter Mann tappst herum. Ich helfe ihm auf die Toilette.
„Das haben Sie sehr gut gemacht“, sagt ein scharfäugiger älterer Mann, der mir gegenüber sitzt und mit dem Flixtrain von München nach Hamburg gefahren ist. 24 Euro, billiger geht’s nicht. Außer Trampen, aber das ist arg, wenn man so viel Gepäck hat wie er oder ich. Er fährt nur bis Rendsburg, wo er ein Wohnmobil abholt. Mit dem fährt er dann zurück, sagt er, nicht mit dem Zug. Das ergibt Sinn, denke ich. Danach will er nach Dalmatien, Dubrovnik und überhaupt überall hin auf unserem schönen Kontinent. Zeit hat er, denn er ist Frührentner. Bis dahin war er Bauingenieur, Projektleiter für Flughäfen, später Leiter der Bauabteilung bei Siemens. In Cuxhaven hat er eine Riesenfabrik gebaut, wo Masten für Windräder zusammengeschraubt werden. Nicht die großen, die ich oben fotografiert habe, sondern die megasuperdupergroßen, die im Meer stehen. Da gibt es weniger Protest von Anwohnern, sagt er. Wahrscheinlich weil es weniger Anwohner gibt, denke ich mir. Aber was weiß ich schon.
In Rendsburg steht eine Moschee neben den Bahngleisen. Wartet wahrscheinlich auf den Orient-Express, haha.

Der rüstige Rentner steigt aus und wird durch eine rüstige Radfahrerin ersetzt. Sie fährt auch bis nach Flensburg und will von dort die Ostsee abradeln. Hoffentlich immer mit Westwind, aber ohne Orkan. Im Regionalzug sind die Leute viel gesprächiger. Sie erzählen aus ihrem Leben, von ihren Reisen, von ihren Plänen. Aber sie scheint in Eile zu sein. Denn als sich die Verspätungen wegen gestörter Signalanlagen und blockierter Gleise aufsummieren, wird sie immer unruhiger: „Schon 46 Minuten Verspätung!“
„Ich finde das gut,“ entgegne ich vergnügt, „je langsamer wir fahren, umso mehr sehe ich von der Gegend.“
Alle Umstehenden lachen, zur Hälfte aus Heiterkeit, zur Hälfte aus Verbitterung. Letztere sind jene, die jeden Tag die gleiche Strecke fahren. Das ist halt auch kein gewinnversprechender Lebensentwurf.
„Ich fahre ja zum ersten Mal durch diesen schönen Landstrich“, versuche ich, die örtlichen Gemüter zu beruhigen. So weit im Norden war ich noch nie in Deutschland. In anderen Ländern schon, in Schottland, in Litauen, in Lettland, in Estland. Wie so viele habe ich zuerst die Welt und erst später mein eigenes Land kennengelernt. Ein Großonkel oder Urgroßonkel war mal in Norwegen. Mit der Wehrmacht. Diese Generation ist echt viel rumgekommen.
Kurz darauf fährt der Zug auf eine Eisenkonstruktion. Eine Brücke, aber auf ganz dünnen Stelzchen, und einen kompletten Kreis beschreibend. Wie auf einer Achterbahn. Faszinierend.
Die wagemutige Brücke dient der Überbrückung eines Kanals.
„Was ist das?“ fragt die Radlerin verwundert.
„Das ist der Kaiser-Wilhelm-Kanal“, wage ich einen vorlauten Versuch.
„Ich dachte, Sie sind zum ersten Mal in dieser Gegend?“
„Ja, aber was soll es sonst sein?“

Sie glaubt mir nicht, guckt bei Google Maps nach, und es stellt sich heraus, dass der Kaiser-Wilhelm-Kanal jetzt Nord-Ostsee-Kanal heißt. Schon wieder so eine Umbenennung aus political correctness. Dabei wurde der Kanal einst für die Wikinger erbaut, damit diese schneller von der Ost- in die Nordsee segeln und rauben und brandschatzen konnten. Diese Ingenieursmeisterleistung war wohl auch das Vorbild für den Panamakanal. Oh, ein Wort mit fünf gleichen Vokalen. Jetzt fühle ich mich herausgefordert: Panamakanalrand. Panamakanalrandsandstrand. Panamakanalrandsandstrandananas. Panamakanalrandsandstrandananassaftbar! Leute, die mit mir im Zug sitzen, wundern sich oft, warum ich beim Schreiben lachen muss. Aber sogleich folgt auf die manische die depressive Erkenntnis, dass diese und andere Spielereien meinen englisch- und anderssprachigen Lesern vorenthalten bleiben. So wird die Welt nie erfahren, was ich eigentlich kann. Ganz ehrlich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man ein glückliches Leben führen soll, wenn man nicht Deutsch kann. Baut mehr Goethe-Institute, von Kandahar bis Samarkand!
Kaiser Wilhelm II. hat wahrscheinlich auch die Moschee in Rendsburg erbaut, denn seiner Meinung nach gehörte der Islam ganz sicher zu Deutschland.
Harry Martinson schrieb: „Nord-Ostsee-Kanal heißt ein langweiliger, altväterlicher Kanal, der immer irgendwie an Onkel Bräsig erinnert. […] Der Suezkanal, der in gerader Richtung durch die öde Wüste verläuft, hat mehr zu bieten als dieser militärische Ackergraben in Holstein. Ein paar hohe, imponierende Brücken sind das Einzige. Aber die sind auch wirklich stattlich.“ Ich habe sein Buch „Reisen ohne Ziel“ im Gepäck, denn in Schweden lese ich gerne schwedische Autoren. Martinson war ein ziemlicher Herumtreiber, gewann aber 1974 den Nobelpreis für Literatur. Erinnert sich kein Mensch mehr daran. Anscheinend sind diese Preise gar nicht so wichtig.
Und schon sind wir in Flensburg. In zehn Stunden quer durchs Land, von Bayern bis in die nördlichste Stadt Deutschlands. Die Stadt, von der aus das Deutsche Reich in seinen letzten Tagen und Atemzügen regiert wurde. Von Admiral Dönitz, der von Hitler als Nachfolger eingesetzt worden war und diesen Job noch drei Wochen ausführte, bis ihn britische Soldaten ins Altersheim abführten.

Es gibt ja jene, die behaupten, dass Dönitz nie kapituliert oder abgedankt habe, dass deshalb das Deutsche Reich fortbestehe und die BRD ein illegitimer Staat sei, und so weiter. Falls Ihr so jemanden kennt, schickt ihm diesen Artikel. Darin räume ich mit all den Falschdarstellungen und Fehlinterpretationen auf.
Jetzt tritt aus dem Bahnhof Flensburg eine dunkelhaarige Bundeswehr-Soldatin in Uniform und küsst innig ihre blonde Freundin, um sodann Hand in Hand in die Stadt zu spazieren. Es hat sich wahrlich etwas getan in Deutschland seit Dönitz. Hier, wegen der nahen Grenze zu Dänemark, vielleicht mehr als anderswo.
Auf zweisprachigen Denkmälern werden dänische und deutsche Soldaten beweint, die 1864 gegeneinander gekämpft haben. Jetzt hängen in der Stadt Wahlplakate des Südschleswigschen Wählerverbandes, einer dänischen Partei, die zur deutschen Bundestagswahl antritt. Die Dänen haben Minderheitenrechte in Schleswig-Holstein, eigene Schulen, eigene Bibliotheken, eigene Kirchen. Parallelgesellschaft würde man es nennen und bekämpfen, wenn es nicht um eine Arierrasse, sondern um Türken, Kurden oder Araber ginge.
Aus der Zeit jener Kriege oder allerhöchstens der des Kaisers stammt auch der Bahnhof von Flensburg. Ohne dass seither irgendetwas modifiziert oder modernisiert wurde. Auf dem „Abort“ gibt es keine Seife, keinen Trockner, kein Toilettenpapier.
Die Stadt an sich, naja.
Ein Bus fährt vorbei, Linie 21. Fahrtziel: Glücksburg. Spontan halte ich die Hand raus, spontan hält er an.
„Einen Fahrschein nach Glücksburg, bitte.“ Der Name gefällt mir, egal, was es dort gibt. Und der Zug nach Dänemark geht erst am Abend, ich habe also Zeit für eine spontane Exkursion. Am Bahnhof gibt es so große Schließfächer, in die sogar ein Seesack passt, also kann ich unbeschwert herumstreunen und Seeluft schnuppern.
„Möchten Sie zum Schloss?“ fragt der Busfahrer.
„Ja, gerne“, sage ich, begeistert, was ich für ein Glückskeks bin. Ein Zufallsbus, und er fährt direkt zu einem Schloss! Das muss das Schloss von Tucholsky sein, erinnere ich mich vage an eine Episode aus des Meisters Leben.
Am Straßenrand steht ein Blitzgerät, und das ist wahrscheinlich, wofür Flensburg den meisten Deutschen ein Begriff ist. Hier werden die Punkte addiert und nur ganz selten subtrahiert, die man durch Rasen und andere Verkehrsverstöße sammelt.
Wenn die Bonuskarte voll ist, steht ein Monat Fahrrad- oder Zug- statt Autofahren auf dem Programm. Alles für den Klimaschutz!
Die Glücksburg ist eine in einer kleinen Burg untergebrachte Stadtbibliothek. Denke ich zuerst. Denn für mich sind Bibliotheken tatsächlich ein Hort des Glücks. Wissen, Information, Zerstreuung, gemütliche Sessel, alles kostenlos und ohne Konsumzwang. Außerdem trifft man dort meist andere schlaue Leute.

Mit dem Schloss meinte der Busfahrer jedoch das Wasserschloss des Prinzen zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, der scheinbar ein Faible für deskriptive Burgnamen hatte. Das Bundesland Schleswig-Holstein hieße auch heute noch Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, wenn nicht die Dänen die letzten beiden Burgen erobert hätten, weil der dänische König darin wohnen wollte. Dänemark hatte wohl keine eigenen Burgen. Das kommt davon, wenn man nur Windmühlen, Atlantikwälle, Öresundbrücken und so praktisches Zeug baut.
Neben dem Schloss liegt ein See, der sich gemütlich umwandern lässt. Und mit umso mehr atheistischer Freude, wenn man erfährt, dass auf dem Grund des Sees das Rüdekloster liegt, das durch Überflutung säkularisiert wurde.
In Abwandlung eines Anwaltswitzes: Was sind tausend tote Mönche auf dem Boden eines Sees? – Ein guter Anfang.
Am See ist es so windig wie am Meer, und es wird kühl. Also zurück zum Bahnhof. Vor dem Schloss steht eine Mitfahrbank, coole Sache. Falls Ihr das nicht kennt, lest gerne in meinem Artikel über Ostbelgien oder über die Nazi-Burg nach.
Aber da kommt auch schon der Bus. Linie 22, aber der gleiche Fahrer wie vorher im 21er. Er fährt nicht in Flensburger Verkehrsverbunduniform, sondern im offenen karierten Hemd über schwarzem T-Shirt. Wie so ein Papa, der als Aushilfe den Schulbus fährt, weil der eigentliche Schulbusfahrer von dieser Behörde in Flensburg aus dem Verkehr gezogen wurde. Daher kommt übrigens die Redewendung.
Er erkennt mich und sagt: „Ach, Sie haben heute doch schon einmal einen Fahrschein von mir gekauft. Gehen Sie einfach durch.“ Sehr nett.
Eine Familie aus Bayern mit zwei Kindern und vier Fahrrädern will die 9 km zurück nach Flensburg nicht mehr strampeln und fragt, ob sie die Fahrräder mit in den Bus nehmen dürfen.
„Eigentlich nicht“, sagt der Fahrer, steigt dann aber aus und hilft ihnen, die Räder zwischen den Sitzen zu verstauen. Sehr nett.
Ein Mädchen steigt ein und fragt: „Halten Sie auch an der Post oder nur beim Bahnhof?“
„Eigentlich nur am Bahnhof, aber wenn Sie zur Post müssen, kann ich Sie da rauslassen.“ Sehr nett.
Als ich aussteige, wünscht er mir noch einen schönen Tag, ohne zu ahnen, wie sehr er dazu beigetragen hat, dass es einer geworden ist. Den schlechten Ruf hat Flensburg nicht verdient. Die Menschen in Schleswig-Holstein sind wirklich nett. Schade, dass der grüne Typ von hier nicht als Kanzler kandidiert. Aber Olaf Scholz kommt ja auch aus dem Norden. Hoffentlich schaffen es meine Briefwahlunterlagen rechtzeitig nach Stockholm.
Weil der oben erwähnte deutsch-dänische Krieg mittlerweile vergessen ist (oder wusstet Ihr etwas davon?), fährt ein flauschiger Zug von Flensburg nach Fredericia. Das „flauschig“ ist nicht nur der Alliteration geschuldet. Der dänische Zug ist gemütlicher als der deutsche. Viel mehr Platz für Gelenke, Gepäck und Gesäß. Tief wie in einem Fernsehsessel sitzt man. Und das ist nur die zweite Klasse. Vielleicht gibt es hier aber auch keine unterschiedlichen Klassen, schließlich beginnt ab hier der skandinavische Sozialismus.
In Padborg, anscheinend schon in Dänemark, stürmen dänische Polizisten den Zug und rufen „Passport! Covid test!“, aber im Ton von „This is a robbery!“ Martialisch marschieren sie durch den Zug, wie wenn sie am liebsten jemanden rauswerfen würden. Ich habe Pass, Covid-Test und einen vollständig ausgefüllten Impfpass, und plötzlich wird der Polizist ganz freundlich. Vielleicht hat er sonst viel mit Corona-Flüchtlingen zu tun, die ihm weismachen wollen, dass es das Virus gar nicht gäbe. Warum versuchen die Querdenker es eigentlich nicht mit Schmuggel? Da können sie dann erklären, dass Alkohol in Wirklichkeit gar nicht schädlich sei und dass Landesgrenzen genauso arbiträr sind wie andere Grenzwerte.
Am nächsten Halt kommen tatsächlich zwei Frauen vom Zoll, werfen aber auch niemanden aus dem Zug. Es ist komisch, innerhalb der EU wieder solche Kontrollen zu erleben. Man hat sich scho ans freie Reisen gewöhnt. Jüngere haben Grenzkontrollen bisher noch nie erlebt und vergessen schon mal ihren Pass zuhause, wenn sie von Finnland nach Frankreich fahren oder von Tallinn in die Toskana touren.
Aber Dänemark hat ja auch einen Zaun aufgestellt, um das Vordringen der Schweinepest aufzuhalten. Vielleicht haben die Zollbeamtinnen nur nach Wild- und Hausschweinen unter den Passagieren Ausschau gehalten. Die Umweltschweine fliegen lieber.

Dänemark ist, glaube ich, Land Nr. 65 auf meiner Länderliste. Aber das ist ja doof, so etwas zu zählen, wenn man nur durchfährt. Noch dazu nachts, wenn man sowieso nichts sieht. Außer die Bahnhöfe. Kleine Orte scheinen es zu sein, Hjordkær, Rødekro, Lunderskov. Nicht viel los. Hauptsächlich Jugendliche steigen ein und aus. Ein Student gegenüber von mir, der seinen Studentenstatus sehr demonstrativ zur Schau stellt, liest einen Aufsatz über soziale Bildungsungleichheit am Beispiel von hochbegabten Kindern in Vorschulen. Oder so etwas. Ich kann ja gar kein Dänisch.
Bald kommt Fredericia, dessen Hauptberechtigung darin besteht, dass hier die Züge nach Osten, also nach Kopenhagen abbiegen können. Der Bahnhof ist ein einziges Skandinavien-Klischee, wie wenn ihn die Dänische Reichsbahn bei IKEA bestellt hätte. Das krasse Gegenteil des wilhelminischen Bahnhofs in Flensburg. Kein Wunder, dass sich an diesen Geschmacksgegensätzen immer wieder Konflikte entzündeten, die mit der Schleswig-Holstein-Frage eine der kompliziertesten politisch-territorialen Fragen in einem an komplizierten politisch-territorialen Fragen nicht armen Europa aufwarf.

Ökonomen teilen Europa in die Eurozone und den Rest. Viel relevanter für Reisende ist die Unterteilung in Bargeld und Elektrogeld. Dänemark gehört jeweils zu letzterer Gruppe. Manche Leute glauben, dass Kartenzahlung moden und einfach und schnell und effizient sei. In Wirklichkeit ist es einfach nur scheiße. Im wörtlichen Sinn, denn die beiden Toiletten im Bahnhof von Fredericia lassen sich nur mit Kreditkarte und Abbuchung von 10 Kronen (etwa einem Euro) öffnen. Weil das Kartenterminallesegerätoderwasweißich gerade nicht funktioniert, kann man sich am wichtigsten Bahnhof in Dänemark nicht die Hände waschen.
Jedes Loch im Boden wäre schlauer und sinnvoller als eine Toilette, zu deren Wiedereröffnung ein IT-Konsultant aus Kopenhagen kommen muss, der einen Code von der Zentrale aus Singapur anfordern muss, die von ihm einen Fingerabdruckscan zur Berechtigung verlangen wird, um einen PIN zu erhalten, den er dann im Waschraum in ein Terminal eingeben muss, der jedoch verschlossen ist, so dass der ganze Bahnhof gesprengt und neu gebaut werden muss. Jetzt weiß ich auch, warum der Bahnhof hier so neu aussieht. Ich weiß nicht, welcher verfluchte Technikfuzzi die Scheißidee hatte, ein Scheißhaus mit einer Scheißkarte zu versperren, aber derjenige sollte eine Woche auf einer Toilette eingesperrt werden. Und zwar ohne Handy. Aber irgendwie passt das zu einem Land, das schon im 10. Jahrhundert von König Bluetooth regiert wurde.
Oder nehmt die Gepäckaufbewahrung. Ein leider aus der Mode gekommener Service, der jedoch äußerst praktisch ist, wenn man mit einem randvoll mit Büchern gefüllten und daher 25 kg schweren Rucksack unterwegs ist. In Flensburg gab es so alte Stahlkästen, man warf ein paar Münzen hinein, drehte den Schlüssel um und war entlastet von der Bürde des Besitzes. Freiheit!
In Fredericia hingegen sehen die Schließfächer super schick aus, wie knallrote, frisch geputzte Olivetti-Kaffeemaschinen, aber – Ihr ahnt es schon – sie sind nutzlos, wenn man keine Kreditkarte hat. Münzen und Scheine schlucken die Designerteile nämlich nicht. Dafür sind sie sich zu fein.

An alle Designer, Planer, Architekten und Entwerfer von irgendetwas, seien es Kaffeeautomaten, Autobahnmautsysteme oder Pandemiebekämpfungspläne: Wenn Ihr glaubt, modern zu sein, und alles auf Kartenzahlung oder Handy-Apps basiert, schließt Ihr damit von vornherein 10 oder 20 Prozent der Bevölkerung aus. Das wäre so, wie wenn man Häuser oder Nahverkehrssysteme plant, die niemand über 65 benutzen könnte. Oder niemand mit körperlichen Einschränkungen. Oder keine Armen. Das ist kurzsichtig, einfältig, dumm und klassistisch. Und nicht modern.
Ein weiteres Problem, dass diese Designer angeblich smarter, in Wirklichkeit aber saublöder Technologie übersehen: Nicht jeder Mensch will, dass eine Menge Unternehmen, die dort Arbeitenden und alle Hacker dieser Welt wissen, wo man wann was gekauft oder benutzt hat. Manche von uns reisen inkognito. Oder sind auf der Flucht. Oder wollen nicht, dass die Ausgaben auf ihrer Kreditkarte mit den Ausgaben der Kreditkarte eines zufällig hinter einem in der Schlange Stehenden und einem anschließend zufällig auf die gleiche Toilette gehenden Terroristen zusammenkombiniert werden. Wegen so einem Scheiß verschwinden Leute für acht Jahre in Guantanamo. Dort haben sie endlich Ruhe vor dem ganzen Internetüberwachungsterror. Was ist denn das für eine Welt, wo man ins Gefängnis gehen muss, um frei zu sein?
Apropos Terroristen: So heißt auch der zehnte Band der höchst empfehlenswerten Schwedenkrimireihe von Maj Sjöwall und Per Wahlöö, in dem der Strafverteidiger Hedobald Braxen Schlussplädoyers hält, die genauso wunderbar zusammenhangslos sind wie dieser Artikel. Ich frage mich immer, wie man zu zweit ein Buch schreibt. Oder sogar zehn Bücher. Eines der lustigstens Bücher ist ebenfalls das Produkt von zwei gleichberechtigten Schriftstellern: „Zwölf Stühle“ von Ilja Ilf und Jewgeni Petrow.
Außerdem machen mit Kreditkarten bediente Schließfächer die Arbeit der dänischen Kriminalkommissare sehr langweilig. Wahrscheinlich gibt es deshalb so viele Schweden- , aber kaum Dänenkrimis. Denn wenn ein Plutoniumschmuggler eine Tasche in einem Schließfach vergisst, z.B. weil er von anderen Plutoniumschmugglern (oder von Atomkraftgegnern) in einen Zustand versetzt wurde, in dem ihm das Erinnern (allerdings auch das Vergessen) verunmöglicht wurde, dann fällt das heutzutage niemandem auf, solange von der Kreditkarte die täglichen Gebühren abgebucht werden. Kein Verdacht. Kein Fall. Keine Ermittlungen. Kein Krimi. Weder in der Buch- noch in der meist enttäuschenderen Filmfassung. Noch enttäuschender als Verfilmungen von Büchern sind übrigens Neuverfilmungen von alten Filmen. Kürzlich sah ich die Neufassung der Glorreichen Sieben von 2016, die aus unerfindlichen Gründen, also wohl Geldgier, die Glorreichen Sieben von 1960 neuverfilmt hat, wobei die Glorreichen Sieben von 1960 bereits eine Neuverfilmung der Sieben Samurai von 1954 sind. Dieser neue Film ist so grottenschlecht, dass sich alle Plutoniumschmuggler der Welt zusammentun sollten, um alle Verantwortlichen bei Metro-Goldwyn-Mayer, Sony Pictures und Columbia Pictures zu vergiften. Und wenn sie sich schon zusammentun, könnten sie auch gleich für bessere Arbeitsbedingungen eintreten. Vielleicht verwechsle ich Plutonium mit Polonium, ich bin ja kein Alchemist. Oder Chemiker, wie man das heute nennt. Die Alchemisten sind jetzt Homöopathen. Die Neufassung der Glorreichen Sieben von 2016 habe ich nur angesehen, weil ansonsten kaum Westernfilme erscheinen. Der letzte gute war die Serie „Godless“ auf Netflix. Wobei ich nicht verstanden habe, wie Jeff Daniels einen einarmigen Banditen spielen konnte, aber in späteren Filmen wieder zwei Arme hat. Bei mir wird hoffentlich nie jemand ein Drehbuch für einen Western in Auftrag geben, denn ich schweife mit jedem neuen Satz um zwei Ecken ab.
Also, lasst mich fortfahren in meiner ludditischen Tirade: Vor zwanzig Jahren oder in münzbasierten Gesellschaften würde der oben erwähnte Plutoniumkoffer im Schließfach (Ihr erinnert Euch hoffentlich noch?) nach ein paar Tagen des Nichtabgeholtwerdens den Verdacht des Stationsvorstehers (der mittlerweile natürlich wegrationalisiert wurde) erregen. Dieser würde den örtlichen Kriminalkommissar rufen und das Schließfach öffnen. Bei einer Currywurst in der Bahnhofskantine, die ihnen die Bedienung auf Kulanz servieren könnte, weil sie nicht jede Ausgabe einer Mahlzeit in einem Computer verbuchen müsste, würden die beiden das weitere Vorgehen beratschlagen. Sodann würden sie den Inhalt des Koffers untersuchen. Anhand der Kleidung und der Bücher würden sie Rückschlüsse auf die Herkunft des Inhabers anstellen. Sie würden die Sandspuren am Kofferboden untersuchen und nachforschen, in welchem Landstrich dieser Koffer zuletzt gewesen sein muss. Sie würden einen harmlosen Ablenkungskoffer wieder in das Schließfach sperren, um zu sehen, ob ihn jemand abzuholen versucht. Schließlich würde der Kommissar den Fall vergessen, der Stationsvorsteher jedoch nicht. Und eines frühen Morgens würde der wie immer pünktliche Nachtzug aus Budapest eine attraktive Frau mit keckem Hut ausspucken, die ganz unschuldig das fast schon eingerostete Schloss zum Schließfach Nr. 017 aufsperrt und den Koffer entnimmt. Dem Stationsvorsteher stockt der Atem. Der Kommissar ist gerade auf dem Weg nach Ägypten, natürlich unerreichbar. Mit dem nächsten Zug könnte die Unbekannte schon wieder weg sein. In 40 Minuten würde sie die Grenze nach Belgien passieren, neutrales Gebiet. Was tun?
Und deshalb waren früher die Bücher und Filme besser. Ebenfalls deshalb findet Plutoniumschmuggel in Transnistrien statt, wo es noch schöne alte Züge im Wohnzimmerlook, einen Schaffner für jeden Waggon und sogar noch den KGB gibt. Die Schaffner verkaufen während der Fahrt an der Theke mit Blümchendecke Frikadellen, Essiggurken und Wodka. Viel Wodka hilft nämlich gegen die radioaktive Strahlung. Habe ich in dem Buch von Swetlana Alexijewitsch gelernt. Die hat den Nobelpreis gewonnen, also muss sie es wissen.
Transnistrien gibt es übrigens wirklich. Genauso wie Abchasien, dessen Hauptstadt Sochumi einen Bahnhof hat, der ästhetisch den Stellenwert symbolisiert, der der Eisenbahn überall auf der Welt zukommen sollte. Ein Bahnhof wie ein Tempel. Ein Bahnhof, grandioser als so manche Universität. Ein Bahnhof wie ein Königspalast. Leider fährt nur ein Zug pro Tag.

Wenn Ihr auf die Links klickt, findet Ihr dort mehr Artikel aus denjenigen Ländern. Soweit ich schon zum Schreiben gekommen bin, was leider selbst Jahre nach den Reisen oft nicht der Fall ist. Manchmal bleiben meine Notizbücher so lange liegen, dass es tatsächlich einmal vorkommen könnte, dass ein Land zu existieren aufhört, bevor ich dazu komme, darüber zu schreiben. Aber trotzdem: Wenn Ihr allen in diesem Artikel aufgeführten Links und den Links in den Links folgt, seid Ihr genauso lange unterwegs wie ich im Zug. Habe ich genau berechnet.
Apropos Zug, um ungewohnt stringent beim Thema zu bleiben: Der nächste geht nach Kopenhagen Lufthafen. Das ist kein Terminal für Flüssiggas, sondern das dänische Wort für Flughafen.

Die Fahrt ist kurz, dunkel und ereignislos. Der unterirdische Bahnhof ist lang, dunkel und ereignislos. Dennoch plane ich hier eine mehrstündige Pause, um im Sonnenaufgang über den Öresund zu fahren. Sonnenaufgangsfotos kommen nämlich immer gut an, v.a. bei der verschlafenen Leserschaft, die selbigen meist verpasst, verschläft und verschlumst. Außerdem wird es am Lufthafen hoffentlich Toiletten und endlich eine Schlafgelegenheit geben, hoffe ich. Ersteres zurecht, letzteres nicht. Die Sitze sind zu unbequem zum Einschlafen. Die wartenden Passagiere und die auf Passagiere wartenden Nichtpassagiere vertreiben sich die Zeit mit lautstarkem babylonischen Telefonieren. Ein Lufthafenmitarbeiter rast mit einer Putzmaschine auf und ab. Diese blöde Maschine, deren Sinn natürlich im Wegrationalisieren von Arbeitskräften besteht, macht so viel Lärm, dass ich verstehe, warum Menschen nicht neben dem Lufthafen wohnen wollen.
Also gehe ich wieder nach unten in die Bahnhofskatakomben und nehme den nächsten Zug nach Schweden, der bis Malmö fährt. Keine Ahnung warum, aber im Zug von Kopenhagen nach Malmö um 2 Uhr nachts sitzen hauptsächlich Jugendliche.
Ein Mädchen ist am Telefon, ganz dramatisch, ganz verzweifelt, ganz aufgeregt:
„Wenn du mir das gesagt hättest, wäre ich nicht abgehauen.“
„Dann war das alles ein schreckliches Missverständnis.“
„Und du meinst das wirklich?“
Anscheinend behauptet er das, denn in Lernacken (Schweden) springt sie auf, stürmt aus dem Zug, sprintet zum gegenüberliegenden Gleis, wo sie ein Zug sofort zurück nach Kopenhagen (Dänemark) und in die Arme des Geliebten bringen wird. Ein Hoch auf die Europäische Union, auf Schengen, auf das grenzenlose Reisen, das es ermöglicht, Beziehungen so kurzfristig zu kitten. Man stelle sich vor, dies wäre an der indisch-pakistanischen oder der nord-südkoreanischen Grenze passiert. Die beiden müssten die Nacht allein verbringen, in Verzweiflung und in Tränen.
Ein Hoch auch auf den grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr im allgemeinen und die Verbindung über den Öresund im besonderen. Das ist wirklich etwas Besonderes, denn zwischen Dänemark und Schweden liegt ein Meer. Das ist aus Wasser, und da fahren für gewöhnlich keine Züge.
Ein unhaltbarer Zustand, befanden die Eisenbahnminister von Dänemark und Schweden. Sie beschlossen, das zu ändern. Allerdings, weil es damals noch keine Handys gab, jeder für sich. So begann Dänemark mit dem Bau eines Tunnels nach Schweden und Schweden mit dem Bau einer Brücke nach Dänemark. Beides große Ingenieurskunst, nur halt nicht ganz optimal koordiniert.
Das Malheur fiel erst auf, als der dänische Tunnel schwedisches Hoheitsgebiet und die schwedische Brücke dänisches Hoheitsgebiet erreichte. Die Ingenieure hatten vergessen, das zu tun, was viele Menschen oft vergessen und was viele viel öfter tun sollten: die Juristen zu fragen. Die hätten ihnen nämlich ohne viel Rechercheaufwand mitteilen können, dass Land A nicht einfach im zu Land B gehörenden Meer Brücken bauen oder Tunnel bohren darf.
Die Juristen beider Länder trafen sich, um die Angelegenheit einvernehmlich zu lösen. Entgegen land- und vielleicht auch seeläufiger Vorurteile sind Juristen sehr kreativ, wovon sich die Leserschaft anhand dieses Blogs überzeugen kann. Sie kamen zu der Vereinbarung, dass der dänische Tunnel auf die schwedische Brücke und umgekehrt führen würde. Abgemacht, unterzeichnet, apostilliert. Ach, würde die Welt doch mehr Konflikte durch Juristen regeln lassen. Nie wieder Krieg!
Zurück in den jeweiligen Eisenbahnplanungsbehörden tobten die Ingenieure: „So ein Unsinn! Das ist unmöglich! Ihr habt sie wohl nicht mehr alle? Auf so eine blöde Idee können auch nur Juristen kommen.“ Aber die Vereinbarung war unterschrieben, da war nichts zu machen. „Pacta sunt servanda“, wie die Juristen sagten, wobei sie, weil sie die Überstunden abfeiern wollten, wohlweislich die Möglichkeit des consensus contrarius verschwiegen.
Und so steigt mein Tunnelzug mitten im Öresund aus dem Meer, um den Rest des Weges auf einer Brücke nach Schweden zu schweben.

Verkehrsanbindung sui generis nennen wir Juristen das.
Und schnell ist der Zug, denn um 2:46 Uhr bin ich in Malmö. Grenz-, Zoll- oder Coronakontrolle gibt es hier nicht. Den Schweden ist das alles egal. Ein Land, das viel Platz hat, hat auch viel Platz für Friedhöfe, denkt sich die schwedische Durchseuchungsbehörde, die seit dem bis 1975 durchgeführten Eugenikprogramm schon lange mal wieder ein großflächiges Experiment wagen wollte. Ist doch schließlich blöd, wenn man den Medizinnobelpokal jedes Jahr ins Ausland vergeben muss.
So schnell hätte der Zug gar nicht sein müssen. Denn jetzt stecke ich in Malmö. Der erste Zug weiter nach Stockholm geht um 7:04 Uhr, so dass mir vier Stunden verbleiben. In Schweden ist die Bahnhofspolitik noch restriktiver als in Dänemark. Hier sind die Toiletten einfach ganz verschlossen und öffnen erst um 6 Uhr. Und wenn man nachts mal muss, fragt Ihr Euch? Tja, damit stellt Ihr schon bessere Fragen als die Doldis, die das so entschieden haben.

Am Bahnhof in Malmö gibt es nichts, was einen vier Stunden fesseln könnte. Okay, ich könnte schlafen wie die anderen Wartenden. Wäre eigentlich auch überfällig. Aber weil in dieser Geschichte noch nichts, rein gar nichts Interessantes passiert ist (was, wie ich mit Blick auf das sich füllende Notizbuch entsetzt feststelle, mich nicht am Schreiben hindert), entscheide ich mich für einen nächtlichen Stadtspaziergang. Dazu muss man sagen, dass Malmö den Ruf als gefährlichste Stadt Europas hat. Bandenkriege, Morde, Bombenexplosionen, Terroristen, so zumindest die Schlagzeilen. Und bestimmte Medien stellen das dann gerne in Zusammenhang mit Einwanderung und insbesondere mit Muslimen. Angeblich sei Malmö eine „no-go area“, wo sich nicht einmal mehr die Polizei hintraue.
Ich bin skeptisch gegenüber solchen Narrativen. Also nutze ich die einmalige Chance, mir die gefährlichste Stadt Europas selbst anzusehen. Nachts, wenn es am gefährlichsten ist. Direkt um den Bahnhof, weil diese Gegend bekanntlich immer die gefährlichste ist. Zu Fuß und allein, weil es so am gefährlichsten ist. Und mit einem übergroßen Rucksack auf dem Rücken, weil die Gepäckaufbewahrung in Malmö nicht elektronisch ist, sondern ganz geschlossen hat. Wahrscheinlich aus Angst vor Kofferbomben. So wie ich aus dem Bahnhof stolpere, könnte ich genauso gut (oder genauso schlecht) eine Fahne herumtragen, auf der steht: „Dummer Tourist, der sich verlaufen hat und sich im Falle eines Überfalls nicht wehren kann.“ Wenn man übermüdet ist, macht man dumme Sachen.
Malmö nachts ist relativ mild. Ich brauche nicht einmal eine Jacke. Malmö nachts ist relativ ruhig. Nur ganz wenige Autos. Eine Frau geht allein nach Hause. Ein arabisch aussehender Jugendlicher fährt mit seinem Fahrrad große Kreise, die Abwesenheit des Autoverkehrs und die laue Sommernacht feiernd. Zwei sehr junge Mädchen fahren auf Elektrorollern vorbei. Das ist für mich immer ein entscheidender Test, egal in welchem Land: Gehen junge Mädchen nachts allein Joggen oder eben Rollerfahren? Wenn ja, dann ist die Stadt kaum so gefährlich, wie man ihr andichtet.
Als ich bei rot über die Ampel gehe, hält das einzige Auto weit und breit mindestens 50 Meter vor der Kreuzung an, um zu signalisieren, dass mich der Fahrer gesehen hat. Obwohl er grün gehabt hätte.
Ich versuche wirklich, mich zu verlaufen, aber es passiert einfach nichts Gefährliches. Keine Schüsse. Keine Drogen. Keine Gangs. Keine Taliban.
Am königlichen Park steht nicht nur das Tor offen, es gibt gar kein Tor. Man spaziert einfach rein, auch mitten in der Nacht. Auch hier kein Verbrechen. Nicht einmal Kiffer oder Vagabunden (außer mir) oder eine weggeworfene Zigarettenkippe. Ein Hase hoppelt neugierig aus dem Gebüsch, als er meine Prinzenrolle – was sonst soll man in einem königlichen Park essen? – rascheln hört. Aber nicht einmal der Hase greift mich an, obwohl diese Tiere für ihre Brutalität bekannt sind.
Übrigens, es tut mir leid, Herr König, aber wenn in Ihrem Land nachts alle Toiletten abgeschlossen sind, tja … Was hätte ich sonst tun sollen? Aber ich glaube, das ist gut für die Blumen.
Erst auf dem Rückweg zum Bahnhof werde ich doch noch Zeuge eines Verbrechens: Ein Elektroroller wurde nicht richtig abgestellt, sondern brutal und rücksichtslos umgeworfen. Und, die kritische Weltpresse hatte Recht, weit und breit keine Polizei. Totales Chaos und Staatsversagen.

Gibt es in Eurer Stadt oder Eurem Land auch „no-go areas“, die angeblich vor Gefahr strotzen? Ich komme gerne vorbei und sehe mir das mal an. (Harlem war ja auch nicht schlimm.)
So verschlafen wie die Stadt, so verschlafen ist der Bahnhof. Die ganze Halle ist leer, noch kein Zug ist wach. Ganz allein beobachte ich den romantischen Sonnenaufgang. Was für eine Wonne, diese Sonne, dichtet mein von der Müdigkeit zerfrorener Körper. Diese Kombination aus der Energie des fernen Feuerballs und den Gleisen, Drähten, Signalanlagen, Schienensträngen ist irgendwie schön. Und alles ist bereit für einen neuen Tag. Einen weiteren Tag, an dem Menschen sicher und zuverlässig durchs Land, über den Kontinent und, so sie wollen, um die Welt befördert werden. Die Eisenbahn ist doch das perfekte Transportsystem. Anders als im Flugzeug kann man überall aussteigen, die Richtung wechseln, eine Pause einlegen. Anders als im Auto muss man sich nicht konzentrieren, sondern kann abschalten, genießen, plaudern, lesen. Sogar schlafen, wenn man mehr Talent dazu hat als ich. Man hat viel mehr Platz und Bequemlichkeit als im Flugzeug, Bus oder Auto. Wenn einem langweilig ist oder man den Gesprächspartner wechseln will, steht man auf und geht in den nächsten Wagen. Man kommt mitten in der Stadt an anstatt 30 km außerhalb. Man hat keine Parkplatzprobleme, keine unerwarteten Nebenkosten, keine Punkte in Flensburg. Und die Eisenbahn hat einfach Stil, Eleganz und Romantik.
Das sind so Fotos, die eigentlich mal ein Buchcover mit Eisenbahngeschichten zieren sollten. Es gibt übrigens ein Buch, dessen Titel eines meiner Fotos schmückt: „The Universe of Things: On Speculative Realism“ von Steven Shaviro.

Das Bild habe ich in Litauen gemacht. Einfach im Wald auf den Rücken gelegt, nach oben fotografiert, auf den Blog gestellt, von University of Minnesota Press entdeckt worden und 150 Dollar bekommen. Schade, dass das nicht öfter passiert. Wahrscheinlich muss man sich da selbst darum kümmern. Aber dann hätte ich weniger Zeit zum Reisen und Schreiben. Lieber arm und ein interessantes Leben als reich und ständig am Computer sitzen.
Zeit für den letzten Zug dieser Reise. Die schwere, schwarze Lok sieht aus, wie wenn sie bis zum Nordpol durchfahren könnte. Aber selbst da fliegen die Leute jetzt lieber hin. Der Zug von Malmö nach Stockholm ist der gemütlichste von allen. Polstersessel wie aus den 1950ern. Holzfurniere wie aus den 1960ern. Ein weicher Teppich. Ein Restaurant an Bord. Und ein netter und quietschvergnügter Schaffner, der sich besonders freut, wenn er verkünden kann, dass wir in Mjölby zwei Minuten früher ankommen. Und bald darauf: „If nothing obscene happens, we will arrive in Linköping two minutes ahead of schedule.“ Na, dann wollen wir mal anständig bleiben.
Das Schloss von Tucholsky war übrigens nicht Glücksburg, sondern Gripsholm. Passt auch besser zu dem alten Schlaumeier. Wenn da ein Zug hingeht, werde ich mir das mal ansehen. Denn Trampen soll schwierig sein in Schweden. Angeblich kann sich hier niemand vorstellen, dass man so arm ist und sich kein Auto leisten kann. Das ist halt der Nachteil der klassenlosen Gesellschaft.

In dem gemütlichen Sessel könnte ich nach zwei Tagen Wachdelirium endlich einschlafen, aber Landschaft und Wetter sind zu schön dafür. Nicht so dramatisch schön wie eine Fahrt durch die Alpen, durch die Anden oder durch Montenegro. Aber hübsch, putzig, lieblich, farbenfroh, irgendwie glückserregend. Ich bin zum ersten Mal in Schweden, aber schon ahne ich, dass es mir gefallen wird. Wenn mir die Stadt zu trubelig wird, fahre ich einfach mit dem Zug ein paar Stationen raus und spaziere durch diese Wälder, über Felder und Farmen, vorbei an mit Elchblut rostbraun gestrichenen Holzhäusern und um einen der 27.000 Seen. Wenn ich nicht rechtzeitig zur Arbeit in Stockholm erscheinen müsste, würde ich jetzt schon aussteigen und Natur einsaugen, einatmen, genießen mit allen Sinnen. Mit dem Zug durch Schweden, das sollte eine von der Krankenkasse finanzierte Therapie für allerlei psychische Zivilisationskrankheiten sein. Eine Kur auf Schienen. Es bräuchte nur noch einen Bibliothekswagen, und man müsste den Passagieren die Handys abnehmen. Und am besten ohne Fahrplan fahren.
Es bleibt so wunderbar grün bis kurz vor den Toren Stockholms. Endstation. Eine ziemlich stilvolle Endstation.

Tja, das war’s. So fährt man mit dem Zug nach Schweden. War jetzt nichts literarisch besonderes, ist ja auch kaum etwas passiert. Also eigentlich gar nichts, weder noch. Weder literarisch, noch passiert, meine ich.
Ich persönlich finde ja, dass sich beim Trampen mehr Abenteuer ergeben. Aber aus der Leserschaft kam die unmissverständliche Forderung nach mehr Berichten von Zugreisen. Der Vorteil der Eisenbahn ist, dass ich dabei die ganze Zeit schreiben kann, weil ich die Fahrer nicht unterhalten muss. Und so bekommt Ihr eben diese Logorrhø serviert.
Aber wenn die Pandemie so richtig vorbei ist, ich schwör’s, dann mache ich Interrail. Drei Monate lang, mindestens. Oder mit dem Zug die Seidenstraße entlang, bis zum Ananasstand in Samarkand. Oder nach Babylon, auf den Spuren von Orient-Express und Bagdad-Bahn. Und das wird dann was Richtiges, nicht so etwas Halbgares und Halbschläfriges.
Apropos Schlaf: Ich kippe jetzt echt gleich um, Leute. Also tschau, tschüssikowski, ich weiß noch nicht, wie man in Schweden sagt. Bis zum nächsten Mal.
Praktische Tipps:
- Von Berlin oder Hamburg aus ginge auch ein Schlafwagen nach Malmö und Stockholm. Aber wer schläft, kann nicht schreiben.
- Der Fahrschein aus dem tiefsten Bayern in den höchsten Norden (ca. 1500 km) kostete bei der Deutschen Bahn nur 60 €. Solche Supersparpreise gibt es in viele europäische Länder.
- Oft sind diese Preise so günstig, dass es sich z.B. lohnt, den Zug von Hamburg nach Basel zu buchen, wenn Ihr nur bis Freiburg müsst. Oder von Karlsruhe nach Danzig, wenn Ihr nach Berlin müsst. Und dann halt einfach früher aussteigen. Das viele Geld, dass Ihr Euch dadurch spart, könnt Ihr gerne an meinen gemeinnützigen Zugreiseblog spenden. Danke!
Links:
- Jetzt seid Ihr sicher auf den Geschmack gekommen. Deshalb habe ich noch mehr Eisenbahnreisen für Euch.
- Und bald gibt es mehr Berichte aus Schweden.